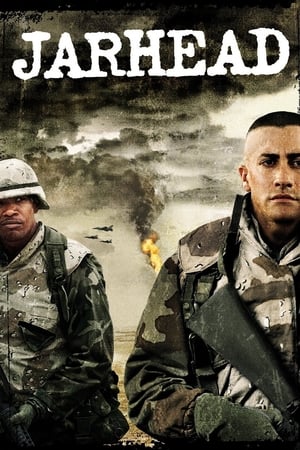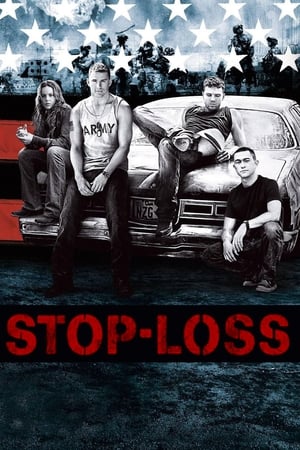Der perfekte Treffer, der John F. Kennedy-Schuss, die rote Wolke. Um nichts anderes soll für Anthony Swofford (Jake Gyllenhaal, Nightcrawler) nach seiner Ausbildung zum Scout Sniper gehen. Dass Sam Mendes (American Beauty) nicht nur Swofford, sondern auch seinen Kameraden des United States Marine Corps jene Aussicht auf einen erfolgreichen Abschuss verwehrt, scheint in Jarhead – Willkommen im Dreck eigentlich keine Überraschung, aber es ist das I-Tüpfelchen auf dem Diskurs eines meisterhaften Filmes, der womöglich als einzig legitimer Nachfolger von Stanley Kubricks Vietnam-Meilenstein Full Metal Jacket gewertet werden darf. Wie schon der britische Genius im Jahre 1987 geht Oscar-Gewinner Mendes dramaturgisch einen ähnlichen Weg und zergliedert seine Narration in Ausbildungs- und Kriegszeit, um sich ganz und gar dem Seelenleben der Soldaten zu widmen.
In Jarhead – Willkommen im Dreck allerdings nimmt der Abschnitt, in dem die Marines tatsächlich auch mal unter Beschuss stehen, kaum mehr als eine Handvoll Szenen des 120-minütigen Handlungsverlaufes ein. Sam Mendes' Schwerpunkt liegt nicht auf brachialen Gefechtssequenzen, sondern auf dem psychologischen Druck des Einzelnen, der zum Töten herangezüchtet wird, aber nicht töten darf. Anthony Swofford, 20 Jahre alt, der sich zwischen College und Armee entscheiden musste und die, wie er bereits nach seinem ersten Tag im Corps feststellt, vermutlich weitaus dümmere Wahl getroffen hat, durchläuft 1989 das obligatorische Bootcamp-Programm: Erst muss er sich einer Gehirnwäsche unterziehen, während simultan dazu die körperliche und handwerkliche Optimierung erfolgt, bis er alsbald zu den Teilnehmern der Operationen Desert Shield und Desert Storm zählt, die den Einmarsch irakischer Truppe in Saudi-Arbien verhindern sollen.
Für Swofford und seine Kameraden aber wird das Ausrücken nach Kuwait vor allem eine Sache: Ein explosiver Nervenkrieg, der den äußeren Krieg vollkommen überdeckt. Nachdem man sich monatelang hat erniedrigen lassen, sich der zermürbenden Drill-Prozedur gestellt hat, um noch ein wenig Ablenkung von dem Gedanken zu haben, dass die eigene Freundin sich einen anderen Typen geangelt hat, ist die Zeit in der Wüste ein einziges Ausharren, Langweilen, Vertrocknen. Verquere sportliche Ertüchtigung in voller ABC-Montur auf der einen Seite, abwarten, ausdörren, durchdrehen auf der anderen Seite. Die Gruppendynamik gerät zusehends in ein Ungleichgewicht aus freundschaftlichem Zusammenhalt und hochentzündlicher Unberechenbarkeit. Der Krieg in Jarhead – Willkommen im Dreck ist eine introspektive Zerreißprobe. In der Ferne schlagen Bomben ein, im Kopf kreisen die Gedanken an das untreue Mädchen in der Heimat.
Mit der konzentrierten Menschenkenntnis, die Sam Mendes bereits in American Beauty hochdekorierte Preise einbrachte und später auch im famosen Zeiten des Aufruhrs auszeichnen wird, untersucht der Engländer die Wesensart des Soldatentum und stößt auf Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten, Diskrepanzen. Jarhead – Willkommen im Dreck ist keine Anklage an den Golfkrieg und seine politischen wie militärischen Mechanismen, sondern eine Anklage an den Krieg per se, die hier nicht belehrend, sondern mit beißender Ironie und gleichzeitig bedrückender Bodenhaftung vonstattengeht. Sam Mendes deckt Zweifel, Panik, Desillusion und seelische Verletzungen ebenso präzise auf, wie er den Glauben an das Handeln des Marines dokumentiert: Und dieser Glaube muss nicht plakativ hinterfragt werden, weil Mendes weiß, dass die Grundpfeiler des Soldatentums bereits von fragwürdigen Werten, fehlgeleitetem Idealismus und nicht zuletzt gesellschaftlicher Alternativlosigkeit gesäumt sind. Viele Männer sind hier, weil sie nirgendwo sonst eine Chance hätten.
Anthony Swofford, auf dessen Autobiographie Jarhead – Willkommen im Dreck teilweise basiert, ist für den Film indes der idealen Protagonist, um die Zerrissenheit der Soldaten inmitten der Kluft von Individualität und Kollektivität zum Ausdruck zu bringen. Auch er hat sich vom Drill anstecken lassen, in seiner Brust pocht die Gier, zum Schuss zu kommen. Gleichwohl ist ihm aber bewusst, dass das Beschwören einer heiligen Bindung zum Gewehr; dass die Gegenwart in der kuweitischen Einöde; dass die Teilnahme an der Mutter aller Kriegen, wie Saddam Hussein den zweiten Golfkrieg nannte, nichts von Bedeutung sein kann. Und das ist es auch nicht. Es ist eine Qual, ein einziges, unaufhörliches Leiden, welches sich über das ganze Leben hinauszieht: Einmal in Berührung mit einem Gewehr gekommen, vergisst man dieses Gefühl nie wieder.
Man bleibt für immer in der Wüste, hilflos, von Anspannung bis zum Scheitel verstaut – ein menschliches Schraubglas, das nicht mehr ist, als ein leeres Gefäß. Jeder Krieg ist anders, jeder Krieg ist gleich. Nicht minder beeindruckend wie die bildgewaltigen, von Surrealismus geschwängerten Eindrücke der in Flammen stehenden Ölfelder, die schwarzen Regen vor infernalischem Lodern auf die Soldaten hinunter regnen lassen, sind selbstredend die schauspielerischen Leistungen. Neben Peter Sarsgaard (Die glorreichen Sieben) und Jamie Foxx (Django Unchained) ist es natürlich Jake Gyllenhaal, der womöglich beste Akteur seiner Generation, der durch eine ungemein pointierte Darstellung brilliert, in der er all seine Emotionen, seine Erschöpfung, seine Wut, sein Entsetzen, beeindruckend kraftvoll darbietet. Eine Performance, die eigentlich alle Türen in Hollywood geöffnet hätte, stünden sie zum damaligen Zeitpunkt nicht schon sperrangelweit offen.
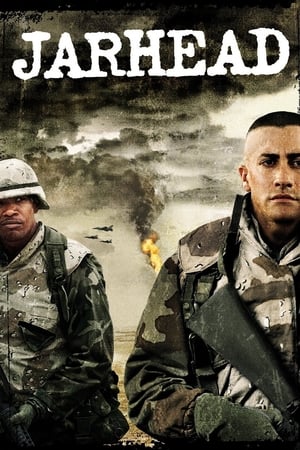 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org