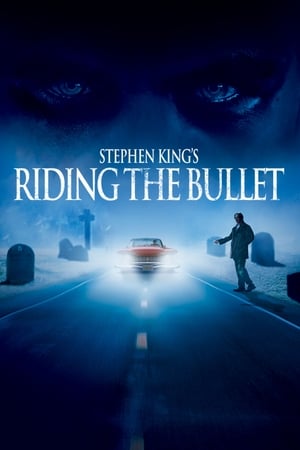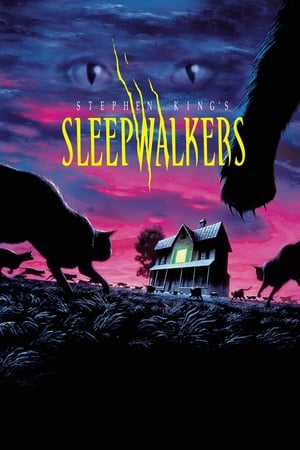Stephen King-Verfilmungen sind seit fast 50 Jahren nicht mehr aus der Filmlandschaft wegzudenken und es ist kein Ende in Sicht. Doch nicht alle wurden für die große Kinoleinwand adaptiert, einige seiner Bücher schafften es „nur“ ins TV, was nicht zwingend für geringere Popularität und Beliebtheit sprechen muss. So gab es von seinem vielleicht berühmtesten Buch Es bis vor einigen Jahren lediglich eine dreiteilige Miniserie aus dem Jahr 1990, die aber auch hierzulande einer ganzen Generation ein nachhaltiges Clown-Trauma bescherte. Mit The Stand – Das letzte Gefecht wurde auch ein weiteres Mammutwerk des Autors bisher lediglich fürs TV ausgewertet, was schlicht am enormen Umfang des Stoffes liegt, so dass ihm im mehrstündigen Format einfach besser gerecht werden konnte. Sein 1996 erschienener Roman Desperation zählt zwar auch nicht gerade zu den kürzesten Lektüren des Schriftstellers, wäre aber in dieser Form mit seiner Nettolaufzeit von unter 130 Minuten unproblematisch für eine Kinoversion, speziell nach heutigen Maßstäben, trotzdem wurde auch er als 3-teilige Miniserie ausgewertet (in den USA, hier erschien er in seiner Gänze direkt auf DVD). Vielleicht wirkte die Romanvorlage als nicht prominent genug, obgleich sie sich qualitativ mühelos in der sehr guten „zweiten Reihe“ der King-Büchern einordnen kann und zudem ein echtes Novum darstellte. Seinerzeit veröffentlichte King parallel unter seinem schon seit Ewigkeiten „enttarnten“ Pseudonym Richard Bachman den Roman Regulator, der eine Art „Multiverse“-Variante von Desperation erzählt. So etwas gab es bis dahin noch nie und bis heute existiert auch noch keine filmische Fassung des Zweitwerks, was aber aufgrund des Inhalts auch kompliziert werden könnte (wer es gelesen hat, wird wissen warum).
Die Regie bei Stephen Kings Desperation übernahm Mick Garris (Critters 2 – Sie kehren zurück), der King-Fans kein Unbekannter sein dürfte – bei dem sie aber wahrscheinlich auch keine Freudensprünge ausüben dürften. So war er u.a. verantwortlich für die schmucklosen TV-Filme Quicksilver Highway (1997) und Stephen King’s Riding the Bullet (2004), aber natürlich auch für den aus einem trashigen Blickwinkel beinah schon kultigen Katzenjammer Stephen Kings Schlafwandler (1992). Was einem aber richtig zu denken geben sollte, ist die direkte Partizipation von King selbst, verfasste er doch das Drehbuch. Sollte das nicht eigentlich ein Vorteil sein? Müsste man normalerweise annehmen, doch wenn einen die Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann dass Stephen King sich bitte aus den Verfilmungen seines Schaffens gänzlich heraushalten sollte. Das liegt ihm einfach nicht und auch er versteht es nicht, die Faszination seiner Werke auf jedwede Form des Medium Films zu übertragen. So sind natürlich viele Szene sehr dicht an der Vorlage, speziell was die Dialoge angeht, aber die sind es ja auch nicht, die einen literarischen Stephen King so auszeichnen. Es ist das detaillierte Skizzieren eines Szenarios, das Kreieren von Stimmung sowie die akribische Charakterzeichnung, die sich oftmals abseits des gesprochenen Wortes abspielt und viele seiner Geschichten so ausufernd gestaltet. Das lässt sich kaum entsprechend transportieren und erst recht nicht von ihm, der das erstaunlicherweise als Einziger immer noch nicht kapiert hat. Betriebsblindheit auf einem ganz neuen Level.
Dieses Problem tritt hier besonders deutlich zu Tage, dabei ist anfänglich durchaus noch Hoffnung vorhanden. Die erste halbe Stunde ist unter den gegebenen Umständen tatsächlich gar nicht so schlecht, ist nahezu identisch zum Buch und funktioniert deshalb, da die Leser*innen auch dort erstmal ohne große Erklärungen mit einer urplötzlich eskalierenden, erschreckend-mysteriösen Situation und einer Handvoll unbekannter Figuren konfrontiert werden. Wenn es dann ans „Kleingedruckte“ geht, schwimmen der Umsetzung von Minute zu Minute immer mehr die Felle davon. Man kann diesem Film (ja, eigentlich eine Mini-Serie, einigen wir uns einfach auf „Film“) buchstäblich beim in sich Zusammenfallen zusehen, ähnlich wie die Personen, die eine unfreiwillig innige Beziehung mit dem steinalten Antagonisten mit einem Herz für Tiere eingehen.
Das liegt zum einen an der drögen TV-Inszenierung, die nie auch nur den Anschein erweckt, dass man das so auch anderweitig verwerten könnte. Wir reden hier nicht von modernen TV-Standards und noch nicht mal vom Maß der Dinge anno 2006, auch da lag die Latte schon wesentlich höher. Die Bildsprache ist zweckdienlich und langweilig, die Musik kommt aus der Archiv-Retorte und kein einziger der im Ursprung sogar zahlreich vorhandenen, theoretisch effektvollen Momente bekommt auch nur annährend die ihm gebührende Bühne. Mit einer besseren Inszenierung und nicht dieser Husch-Husch-fertig-Mentalität könnte man hier so viel mehr generieren, aber das ist ein reines Abarbeiten. Störend sind zudem die sichtlichen „Cliffhanger-Brakes“, wenn in der TV-Fassung die Werbeunterbrechungen oder eben die Übergänge zur nächsten Episode kamen. Dabei dürfe jedem im Publikum durchaus bewusst werden, dass die Story an sich wirklich interessant ist und Langatmigkeit kann man der Produktion eindeutig nicht vorwerfen. Da passiert ständig etwas, das die Geschichte effektiv vorantreibt, was natürlich auch daran liegt, dass speziell in der zweiten Hälfte einiges aus der Vorlage komprimiert, gestrichen oder abgeändert werden musste, um das Timelimit einzuhalten. Gehört dazu, aber wenn es auf Kosten der Grundqualitäten der Vorlage geht, ist es fatal.
Schon der Roman hatte eine etwas größere Baustelle und das war ausgerechnet der 12jährige Protagonist David (Shane Haboucha, Everwood), dessen ausgeprägte Religiosität den Dreh- und Angelpunkt der Story bildete. Das war schon im Buch manchmal etwas prätentiös, ließ sich aber durch die umfangreiche Erläuterung seiner Figur und seiner Motive noch verständlich gestalten. Es war nicht perfekt, aber funktionierte im Endeffekt. Die mangelnde Figurenzeichnung – allerdings aller Beteiligten – entwickelt sich hier schnell zum Desaster. Da sind wir wieder beim Grundproblem vieler King-Adaptionen: was er durch innere Monologe, schwer für einen filmischen Fluss umsetzbare Zeitsprünge, Rückblenden oder Gedankenspiele ausdrückt und erlebbar macht, fehlt komplett (oder wird durch mangelhafte Alternativen ersetzt). Daran scheiterte auch jede Friedhof der Kuscheltiere-Versionen bisher und hier ist es spätestens im letzten Drittel ein komplettes Todesurteil. David wirkt wie ein geklontes Sektenkind aus der schlimmsten Ecke des Bible Belt und auch die Motivation von John (Tom Skerritt, Dead Zone) im Schlussakt erscheint ohne Kenntnisse der literarischen Vorlage mehr wie ein spontan eingetretener Hirnschlag. Da funktioniert in der dargestellten Form nichts mehr und selbst die am Anfang teilweise noch ordentliche Inszenierung – oder nennen wir es mal lieber „Schilderung der Ereignisse“ – verliert jegliche Effizienz. Da sterben lange Weggefährten – mit sehr, sehr starker Bindung für einige Figuren – einfach so weg, aber das Publikum juckt da eh nicht, da gerade die Nebenfiguren überhaupt kein Profil spendiert bekommen. Ob und wie die sterben macht emotional gar nichts, wird auch entsprechend unspektakulär hingerotzt, obwohl es in der Theorie (bzw. der Vorlage) teilweise richtig tragisch ist.
Gibt es denn etwas, was es bis auf den soliden Start halbwegs zu loben gibt? Eigentlich nur Ron Perlman (Hellboy), der tatsächlich eine Idealbesetzung für seinen Part ist, aber eben auch nur eine begrenzte „Haltbarkeit“ besitzt. Und bezeichnend dafür schmiert mit seinem Verschwinden alles ins beinah Bodenlose ab. Es gibt de facto immer noch schlechtere King-Verfilmungen, aber nur wenige, die es schaffen, obwohl einer in vielen Punkten sehr nahen Werkgetreue und sichtlichem Potential, im Laufe der Zeit sämtliche Kritikpunkte der Vorlage überdeutlich ins Schaufenster zu stellen und noch aufzupumpen, während die Qualitäten irgendwann gar nicht mehr vorhanden sind. Das schafft auch nicht jeder.
 Trailer
Trailer