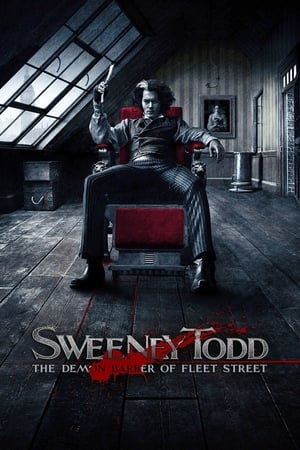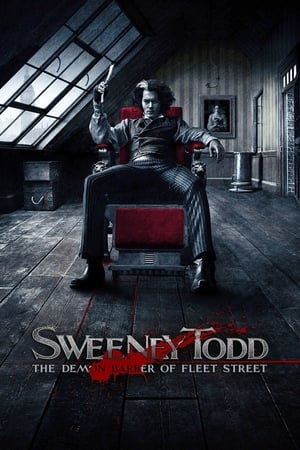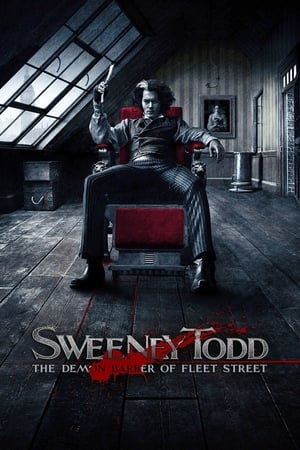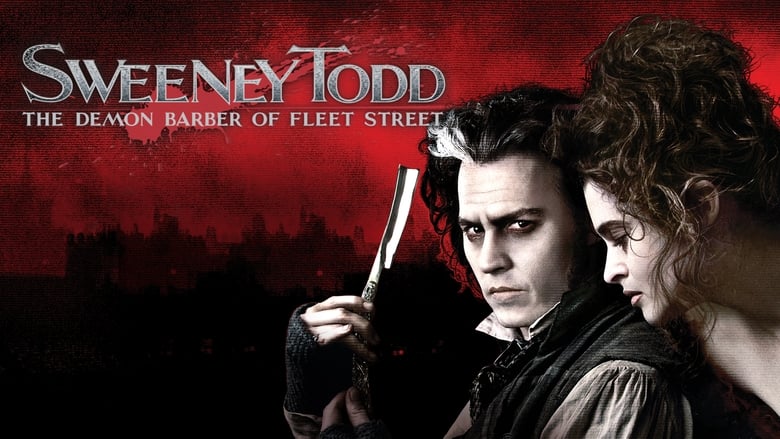Alle paar Jahre passiert es, dass Hollywood sich auf die Tradition großer, imposant ausstaffierter Musicals besinnt und sie mit einem stimmgewaltigen Star-Cast ins Oscar-Rennen schickt. Meistens werden diese dann mit zahlreichen Nominierungen bedacht und in Kategorien wie "Bestes Kostümdesign" oder "Bester Filmsong" ausgezeichnet, wohingegen sie in den Königsdisziplinen meist den Kürzeren ziehen. Werke wie Rob Marshalls Chicago, welcher 2003 bei Bester Film sogar das Fantasyepos Der Herr der Ringe: Die zwei Türme ausstechen konnte, oder aber der "Beinah"-Gewinner La La Land von 2017 bilden hier die Ausnahme. Hat man das nun bei Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street im Hinterkopf, welcher trotz drei Nominierungen (Hauptdarsteller, Kostüme, Szenenbild) schließlich nur den Goldjungen für Letzteres mit nach Hause nehmen konnte, kann man schnell auf die Idee kommen, auch diesen Streifen darunter zu verbuchen.
Doch beginnen die Unterschiede zu typischer Musical-Oscarware schon mit den Namen sowohl vor, als auch hinter der Kamera. Statt einem genre-erprobten Rob Marshall (Nine) traute sich mit Tim Burton ein eigenwilliger Traumfabrik-Virtuose auf den Regiestuhl. Und zumindest zu dieser Zeit galt noch die Faustregel: wo ein Tim Burton ist, da ist auch ein Johnny Depp (Fluch der Karibik) nicht weit, geschweige denn Burtons damalige Muse Helena Bonham Carter. Dieses künstlerische Dreigestirn wagte sich nun aber mit einem echten Musical nicht nur auf völlig unerforschtes Terrain, sondern auch an ein wahres Kultobjekt heran. Sweeney Todd, die makabere Legende vom Barbier, der seinen Kunden nicht bloß die Bärte schneidet, gehört bis heute nicht nur den größten Broadway-Erfolgen überhaupt, sondern hat in der Ur-Inszenierung von 1979 mit Len Cariou und Angela Lansbury in den Hauptrollen auch nach wie vor einen hohen Bekanntsheitsgrad und Stellenwert. Noch dazu gelten die teilweise hart dissonanten Harmonien und Texte, die Musiker Stephen Sondheim seinerzeit an den Klängen von Bernard Herrmann zum Hitchcock-Meilenstein Psycho inspirierte, als dessen persönliches Meisterwerk. Denkbar also keine sonderlich leichte Aufgabe für die Combo Burton/Depp/Carter.
Doch auch wenn Tim Burton in seiner Filmografie schon immer wahlweise zwischen knallbuntem Exzess (Mars Attacks, Pee-wees irre Abenteuer) oder düsterer Gothic-Fantasie (Sleepy Hollow, Batmans Rückkehr) pendelte und sich beide Markenzeichen gleichermaßen auch hier wiederfinden lassen: Sweeney Todd ist womöglich sein bis dato düsterster Film. War die Farbpalette bereits in Sleepy Hollow, ebenfalls mit Johnny Depp in der Hauptrolle, fast schon zu einem trostlosen Schwarz-Weiß heruntersaturiert, setzen Burton und Kameramann Dariusz Wolski diesem nochmal einen drauf.
Nachtschwarz, dreckig und verkommen, erscheint diese Vorstellung des viktorianischen London, das sie, gemeinsam mit dem oscarprämierten Produktionsdesign von Dante Ferretti, heraufbeschwören. Wenn Depps Sweeney Todd bei seiner Rückkehr die Heimatmetropole als "Jauchegrube, in welcher das Geschmeiß der Welt haust" mit zusammengepressten Zähnen besingt, ist man spätestens nach der anschließenden Kamerafahrt durch die Fleet Street gewillt, es ihm gleichzutun. Irgendwo zwischen der sozialen Zeitgeist-Kälte eines Charles Dickens und den pulsierenden Fieberträumen aus Blut und Schmutz in From Hell, siedelt Burton diese abgründige Vision an. Bisweilen könnte man dieses London als den heimlichen dritten Hauptdarsteller bezeichnen, der, zumindest rein visuell, im starken Kontrast zu den Figuren steht.
Besonders Johnny Depp und Helena Bohnham Carter stechen mit ihrer dauerfahlen Blässe und Augenringen zwar aus dem kohlrabenschwarzen Ambiente hervor, doch im Innern sind sie moralisch ebenso verkrüppelt wie ihre unwirklich erscheinende Umwelt. In diesem beengten, vorindustriellen Moloch gilt das Leben von denen, die wenig haben, sogar noch weniger als von Wohlhabenden wie Richter Turpin, welcher selbstgerecht über eingeschüchterte Straßenkinder zu Gericht sitzt. "We all derserve to die" lautet das vorherrschende Kredo, für das Turpin einsteht und welches Depps Sweeney Todd sich in dem brachial-tragischen Ballade "Epiphany" stimmgewaltig aneignet. Komplettiert wird das durch zwei Gesangseinlagen, in denen (Anti-)Held und Antagonist aufeinandertreffen und über ihre gemeinsame Faszination für schöne Frauen sinnieren, wobei Depps Rasiermesser stets wie ein Damoklesschwert über der ganzen Szenerie hängt. Hier erschafft Tim Burton, trotz leicht ironischer Spitzen, wahre Gänsehautmomente, die sowohl Depp als auch dem (mittlerweile leider verstorbenen) Alan Rickman Gelegenheit bieten, die eigentliche Verletzlichkeit ihrer Figuren zutage treten zu lassen. Überhaupt mimt Depp den verbitterten, rachsüchtigen Barbier mit relativer Zurückhaltung, nur um dann in finsteren Schlüsselmomenten dessen ganze Brutalität und Tragik auf die Zuschauer herniedergehen zu lassen.
In Sweeney Todd wird zwar schätzungsweise zu 75-80% gesungen (weshalb der Film auch von Musicalmuffeln unbedingt im englischen Originalton gesehen werden sollte), getanzt wird hier jedoch nur selten. Und wenn doch, dann ist es kaum mehr als ein makabares "Steppdichein" zwischen Todd und Mrs. Lovett, die in diesen Momenten allein ihr Hass auf die Obrigkeit vereint. Das alles garnieren Burton und sein Drehbuchautor John Logan (Penny Dreadful) mit bitterbösem Humor, wenn sie beiden scheinbar die Macht über Leben und Tod überantworten und darüber wild fabulieren lassen, zu was sich die draußen vorbeilaufenden Menschenmassen denn genau am besten verarbeiten bzw. verköstigen ließen.
Obwohl hier keiner der Schauspieler ausgebildeter Sänger ist, liefert der illustre Cast mehr als souverän ab. Dabei mögen die Gesangsstimmen der Darsteller zunächst gewöhnungsbedürftig sein, doch hinterlassen sie alle zumindest einen bleibenden Eindruck. Hervorstechen kann dabei besonders der Auftritt von Sacha Baron Cohen (Borat), welcher mit beeindruckender (und geradezu absurder!) Kopfstimme auftrumpft. Ebenfalls als junges Gesangstalent empfiehlt sich Ed Sanders als Waisenkind Toby, das im Verlauf der Handlung zwischen die Fronten von Todd und Mrs. Lovett gerät. Aber auch Helena Bonham Carter ist die Passion für Rolle, die zu Anfang für die "schlechtesten Fleischpasteten in London" berühmt-berüchtigt ist, hingegen mehr als nur anzuhören, was eventuelle Bedenken über die Besetzung durch ihren (Ex-)Mann Tim Burton rasch zerstreuen dürfte. Der Film widmet ihr sogar die Nummer "By the Sea", in welcher sie offen ihre Hoffnung einer Patchwork-Familie mit Todd und Waisenkind Toby zum Besten geben darf. Hierfür bricht Sweeney Todd dann sogar kurzzeitig aus seinem bisherigen (Farb-)schema aus, was angesichts der beinahe durchweg tristen Grundstimmung fast schon wie ein (buchstäblicher) Ausflug ins Surreale anmutet.
Überstilisiert ist Sweeney Todd aber ohnehin bis ins Mark. Ob nun das zappendüster gesättigte Setting, die großen Gesten, die aber nie gänzlich in Kitsch abgleiten, oder aber ganz schlicht: das Blut. Bereits in der Titelsequenz, die kaum burtonesker daherkommen könnte, suppt der zähflüssige Lebenssaft in dicken Rinnsalen über den Bildschirm, nur um sich dann wie gleich mehrere rote Fäden durch die gesamte blutige Erzählung zu ziehen. Dabei überspitzt Tim Burton aber die Farbe, Konsistenz und vor allem den Einsatz von Kunstblut, das geradezu in Sturzbächen und Fontänen aus den Kehlen quillt, so sehr, dass es schon bizarre Züge annimmt. Das bedeutet aber keineswegs, dass es den zusehends brutaler werdenden Mordsequenzen an ebenso inszenatorischer wie auch emotionaler Wucht mangeln würde.
Im Kern mag Sweeney Todd eine relativ einfache Rache-Story bieten, in welcher die Einflüsse von Der Graf von Monte Christo, die Stephen Sondheim in die Bühnenadaption nach Christopher Bond einfließen ließ, ebenso deutlich spürbar sind wie die offenkundige Bühnenherkunft. Dennoch durchzieht die makabere Mär, bei aller grafischen Gewalt und schwarzem Humor, eine düstere Romantik, die bisweilen in bittere Melancholie umschlägt. Kulminieren tut das in einigen hervorstechenden Gesangsmomenten und vor allem im (kunstblut-)haltigen Finale, was Burton dieses morbide Meisterstück in einem der poetischsten Schlussbilder gipfeln lässt, die der (un-)angepasste Hollywood-Querkopf vielleicht jemals hervorgebracht hat.
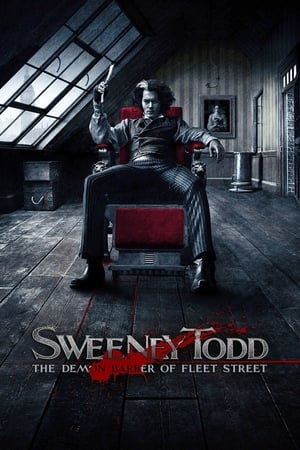 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org