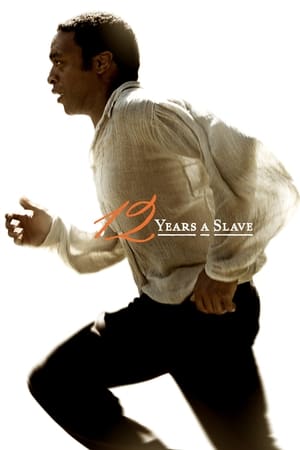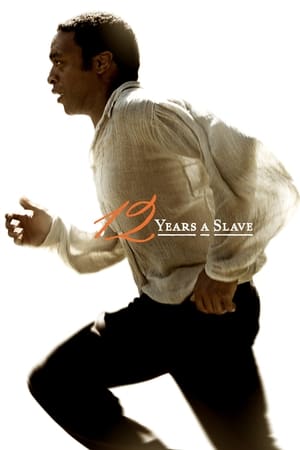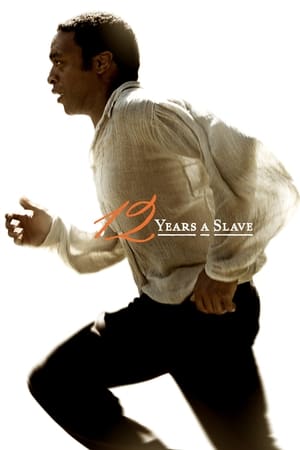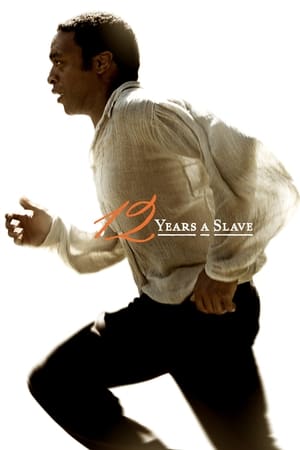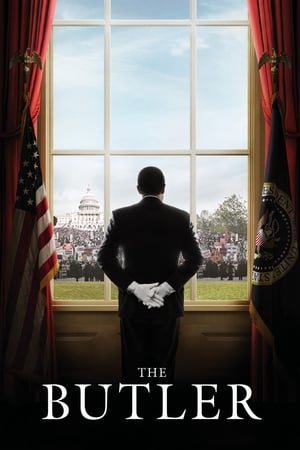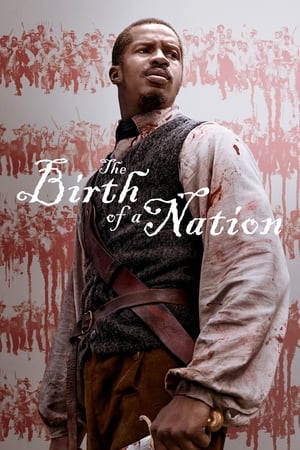Nicht oft gibt es Filme, die es schaffen nur in ihrer Existenz und Vollkommenheit wirklich tiefgreifende Emotionen zu wecken. „Schindlers Liste“ ist ein Vertreter dieser Art, der in der Mittelstufe den pubertierenden Schülern gerne mal vorgeführt wird, um die Schrecken des Holocausts zu verdeutlichen, die in der heutigen Zeit mit dem Einzug neuer Medien und ahnungslosen Eltern einfacher an „Ab 18“-Inhalte kommen, als je zuvor und entsprechend abstumpfen. Denn weder ein gut geschriebener Text, noch ein echtes Foto, noch ein Film, können auch nur ansatzweise die gleiche Wirkung entfalten, als eine schockierende, desillusionierende Erfahrung. Sowohl ein Text, ein Foto und Musik, als auch Filme und Videospiele können eben eine "Erfahrung" sein und mehr, als nur ein „Produkt“. Ein Erlebnis, das durch Atmosphäre, Dialog, Anmut, Ton und Optik Menschen zum Umdenken bewegt. Was „Schindlers Liste“ für den Holocaust ist und „Die Letzten Glühwürmchen“ für Hiroshima und Nagasaki, findet die amerikanische Sklaverei ihr Pendant in Steve McQueens„12 Years A Slave“.
Obwohl man denken könnte, dass geschichtliche Tragödien nicht gerade selten als Inspiration und Vorlage für Künstler dienen, entpuppt sich die Liste der Filme über die amerikanische Sklaverei als geradezu mager und schmächtig. Neben Spielbergs „Amistad“ und Tarantinos „Django Unchained“ fällt kaum ein weiterer Film aus jüngerer Vergangenheit ein, welcher sich diesem schweren Thema annahm. Ein leider trauriger Fakt, dank welchem aber Steve McQueens Historien-Drama „12 Years A Slave“ besonders groß hervorsticht. Und obwohl Tarantinos Sklaven-Drama in seiner folternden Brutalität schockierend und scheußlich sein konnte, bezog es seinen gesamten Reiz, wie jeder Tarantino-Film zuvor auch, von seiner Regie- und Kameraarbeit, den poppig-funkigen Musik-Tracks, dem übertriebenen (und unfreiwillig komischen) Splatter und natürlich seinen Dialogen. Der allseits beliebte Regisseur brachte die Sklaventhematik zwar ordentlich über die Ziellinie, war sie allerdings zu keinem Zeitpunkt wirklich „furchteinflößend“. Ein Punkt, dem sich „12 Years A Slave“ vollends widmet und aus dem es seine Existenzberechtigung schöpft. In den ersten Minuten des Dramas verläuft alles ruhig, geradezu idyllisch und absurd. Solomon ist frei, in einem Amerika, in dem sein Volk versklavt wird, er hat eine Familie und ist wohlhabend. In dem Moment, in dem er den baumwoll-weißen Lumpen auf seinem Oberkörper und die Ketten an seinen Gliedmaßen bemerkt, wird dem Zuschauer eindeutig klar gemacht, in welcher Situation er sich befindet.
Es ist, wie mit den Schülern, die über Sklaverei in einem Buch lesen und alles Wissenswerte darüber lernen. Aber zu sehen, wie einem angeketteten und hilflosen Mann mit einem stacheligen Holzprügel der Rücken blutig und jeglicher Widerstand aus der Seele geschlagen wird, ist ein vollkommen neues Level. Ein Level auf welches Regisseur McQueen den Zuschauer innerhalb der ersten zehn Minuten mit der ersten Folter-Szene hievt und geradezu eine klare Ansage macht. Die Ansage, dass dies nur der Anfang ist. Denn die intime Spannung, die mit der ersten Verstümmelung eingefangen wird, entwickelt sich und nimmt geradezu die Stellung eines Hauptdarstellers ein, der in jeder Szene meist im Hintergrund agiert, stets spürbar ist und nur in Extremsituationen auf den Plan tritt. Die Folter wird mit der unbeweglichen Kamera geradezu zelebriert, keine Schnitte unterbrechen das Bild. Innerhalb einer halben Minute verwandelt der Sklavenhändler Solomons Rücken in eine Narbenruine, während dieser den Schmerz aus den Lungen zu pumpen versucht. Steve McQueen zeigt die Sklaverei von ihrer brutalsten Seite und versetzt das Publikum in einen haareraufenden Schockzustand, welcher die gesamte restliche Laufzeit über in der Luft schwebt. Denn sowohl die gefühlt-minutenlangen, schnittlosen Aufnahmen einer einzigen Szenerie, die Brutalität und der Terror, als auch das grandiose Schauspiel aller Darsteller durchziehen und tragen den ganzen Film.
Die wahre Geschichte des in die Sklaverei entführten Solomon Northup eignet sich gerade deshalb so nahezu perfekt als dramatische Filmadaption, da sich der Zuschauer mit Solomon identifizieren kann. Wie das Publikum auch, erlebt Solomon die Grauen des Knechtdaseins zum ersten Mal und steckt das Publikum selbst in die Schuhe eines schwarzen Baumwollpflückers. Anstatt das Leben von einem in die Sklaverei geborenen Menschen zu erzählen, die nicht zu selten dem Stockholm-Syndrom verfielen und ihre „Master“ zu lieben lernten (was ebenfalls im Film behandelt wird), gibt uns Steve McQueen die Geschichte eines stolzen Mannes, der in die Haut eines Sklaven mit Peitschenhieben gequetscht wird. Solomon lernt Beleidigungen mit Schweigen zu ertragen, Misshandlungen einzustecken und ersetzt seine gehobene Sprache durch das Nuscheln eines Feldarbeiters. Wenn Solomon zu Beginn noch zu protestieren versucht und dem Zuschauer ein „Sei doch still, du Idiot.“ herausrutscht, ist dies Beweis genug, dass das unbeteiligte Publikum sich schneller an seine Ketten gewöhnt, als der ehemalige Musiker selbst.
„12 Years A Slave“ basiert auf dem autobiographischen Buch von Solomon Northup selbst, veröffentlicht 1853. Steve McQueen und Drehbuchautor John Ridley strukturieren den Film wie eine Serie von Anekdoten, wie ein Tagebuch. Über die Dutzend Jahre wechselt Solomon immer wieder den Besitzer, doch sind es zwei Plantagenbesitzer, die hierbei hervorstechen. William Ford (Benedict Cumberbatch), ein gutmütiger und gütiger Familienmensch und Edwin Epps (Michael Fassbender), ein zähnefletschender, lüsterner Tyrann, der die Rolle des Amon Göth aus „Schindlers Liste“ in dieser Geschichte besetzt. Obwohl der Film durchzogen ist mit Szenen der Hoffnung, der Angst und des Schmerzes, verfällt „12 Years A Slave“ nie in die stereotypischen Gefilde eines „emotionalen Filmes“, der ums Verrecken auf Emotionen getrimmt ist (Spielberg's "Gefährten" lässt grüßen). Die Gefühle finden auch ohne die Hilfestellung des Regisseurs ihren Weg in den verdrehten Magen und in die verzweifelten Gedanken des Zuschauers. Die Bilder, die Steve McQueen allein mithilfe der Kamera und den Darstellern kreiert, strotzen dabei nur so von Bildgewalt, trotz (oder gerade wegen) ihrem Minimalismus. In einer Szene, in der Solomon an einem Galgen hängt und seine Zehenspitzen den matschigen Boden nur streifen, gerade genug um ihm das Röcheln zu erlauben, übernimmt die Kamera den Status eines Beobachters und hält etwa sechzig Sekunden starr und unbeweglich auf den nach Luft ringenden Solomon. Nie war Sklaverei unangenehmer anzusehen, nie war sie im Medium Film so real, wie in dieser einen Bildeinstellung.
Ebenso zeichnet sich ein gefühlt-stundenlanges Blickduell zwischen Solomon und dem rassisch-besessenen, psychopathischen Edwin Epps durch seine intime Bescheidenheit in der Inszenierung aus. Solomon vertraute einem weiß-häutigen Arbeiter seine Geschichte an und bat ihn darum die Behörden von der Ungerechtigkeit zu informieren. Dieser verriet ihn jedoch bei Epps, welcher eines Nachts Solomon hinaus führt, seinen Arm um die Schulter des Sklaven legt, nur Zentimeter ihre Gesichter trennend, konfrontiert ihn Epps mit seinem „Fluchtversuch“. Als sich Solomon der Affäre mit einer geschickten Lüge entzieht, ist es der unendlich-lange und unerträgliche Blickkontakt zwischen dem sadistisch-grinsenden Epps und dem zu Tode verängstigten Solomon, der die Nackenhaare aufrichten und das Blut gefrieren lässt. Erneut erledigen nur die beiden Darsteller Ejiofor und Fassbender die Arbeit, während sie mit der endlosen Stille und dem Gezirpe der Grillen kooperieren und das Publikum auf die Folter spannen.
Edwin Epps entwickelt eine manische Besessenheit gegenüber der jungen Sklavin Patsey und vergewaltigt sie regelmäßig. Die Frau des verrückten Plantagenbesitzers ist sich den Obsessionen ihres Mannes durchaus bewusst. Die Figur der Patsey entwickelt sich indes zum seelischen Mittelpunkt des Films, die einerseits von ihrer Todesangst vor Epps angetrieben wird, andererseits den Torturen und Misshandlungen von Epps' Frau zum Opfer fällt, die ihrer Eifersucht nachgibt. Patsey lebt ein Leben in absoluter Qual, es kommt letztendlich so weit, dass sie Solomon darum bittet, dass er sie im Fluss ertränkt. Als er einige Zeit später Patsey selbst auspeitschen muss, wünschen sich sowohl Solomon, als auch der Zuschauer, er hätte es getan.
Bisher fiel Chiwetel Ejiofor zwar nicht besonders groß auf, dennoch entpuppt sich die Besetzung des Solomon mit dem gebürtigen Londoner als wahrer Geniestreich. Ejiofor vermag es nicht nur die (vergleichsweise einfache) Aufgabe zu meistern, den Familienmenschen und Musiker über die Bühne zu bringen, es ist die schleichende Transformation vom Menschen zum „Stück Fleisch“, die Zeuge von den Künsten des Briten sind. Wenn man zu Beginn einen normalen Mann sieht und eine Stunde später plötzlich bemerkt, wie Ejiofor sich bewegt, mit geducktem Kopf, offenem Mund und leerem Blick, ist es nicht möglich genau zu sagen, ab welchem Zeitpunkt der Sklave den Körper übernommen hat. Den Großteil seines Schauspiels transferiert der Hauptdarsteller durch seine Mimik, da Sklaven weder Widerworte geben, noch ihre Meinung äußern dürfen, die Regisseur McQueen mit langen Kameraeinstellungen vollends auskostet. Zudem gibt Michael Fassbender, der sich in den letzten Jahren zum absoluten Charakterdarsteller hochgearbeitet hat, die Performance seines (bisherigen) Lebens. In seiner psychopathisch-manischen Besessenheit lässt er den hervorragenden Ralph Fiennes aus „Schindlers Liste“ weit hinter sich und katapultiert sich in neue Höhen schauspielerischer Qualität.
Wenn man selbst als Beobachter bei jedem Auftritt Fassbenders sich in den Sessel drückt, in Vorbereitung auf das, was wohl kommen mag, ist dies wahrlich eine große Leistung, die man nur zu selten vor die Augen kriegt. Die junge Darstellerin Lupita Nyong'o der Figur Patsey legt indes mit ihrem ersten Spielfilm eine absolute Glanzleistung hin und öffnet sich aus eigenem Können die Tore zu einer großen Karriere. Selbst die kurzen Gast-Auftritte großer Stars, wie Paul Giamatti, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson, Scoot McNairy, Michael K. Williams und Brad Pitt verkommen nicht zu kurzen selbst-referenziellen Cameos, sondern spielen allesamt kleine, aber wichtige Figuren auf aller höchstem Schauspiel-Level. Hans Zimmer findet nach all den Action-Filmen in den letzten Jahren wieder zu seiner wahren, stimmungsvollen Größe zurück, indem er diesmal nicht unbedingt eine laute, effektvolle Orchester-Orgie abfeiern muss, um in großen Action-Szenen Schritt zu halten, sondern ehrt und umarmt die langsame Inszenierung und den Schrecken der Handlung in seiner Musik. Gerade Filme, wie „Der Schmale Grat“, „Der König der Löwen“, „Rain Man“ und „Gladiator“, beweisen, dass der deutsche Komponist sich mit langsamen und emotionalen Stücken am besten auszudrücken weiß.