Quelle: themoviedb.org
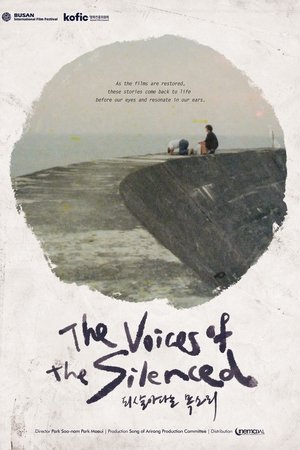
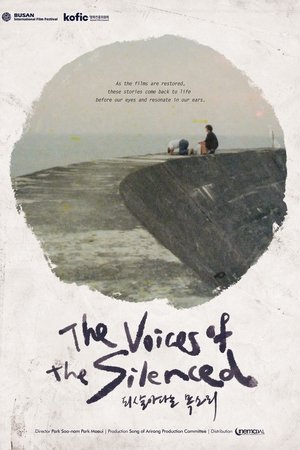
- 137 Min HistorieKriegsfilm
- Regie Park MaeuiPark Soo-nam
- Drehbuch
- Cast Jeon Dong-rye, Nobuto Hirano, Seo Jeong-Woo, Kim Seong-soo, Lee Yong-im
Inhalt
Kritik
Fazit
Kritik: Lida Bach
Moviebreak empfiehlt
-

Mother and Daughter, or the Night is Never Complete
Dokumentarfilm
-

Die Katzen vom Gokogu Schrein
Drama, Kurzfilm
-
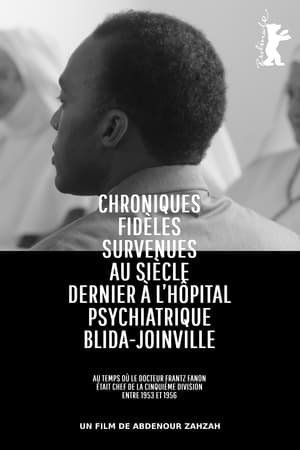
True Chronicles of the Blida Joinville Psychiatric Hospital in the Last Century, when Dr Frantz Fanon Was Head of the Fifth Ward between 1953 and 1956
Drama, Historie
-

Mit Einem Tiger Schlafen
Wird geladen...
×