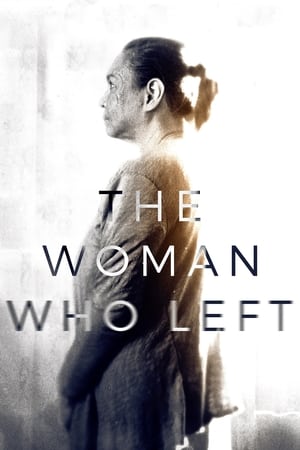Dichte Nebelschwaden ziehen durch eine chinesische Trabantenstadt. Alles ist verwahrlost und dreckig, jeder Blick scheitert an grauen Häuserblocks. Am Anfang und am Ende steht der Tod – es ist die Perspektivlosigkeit eines trostlosen Weltbilds, welches in An Elephant Sitting Still jede Faser der Gesellschaft durchwirkt. In bedächtigen 230 Minuten erzählt Hu Bo die Geschichte vierer Menschen, deren Weg sich nach und nach kreuzt. Der Schüler Wei Bu (Yuchang Peng) befindet sich auf der Flucht, nachdem er einen Schläger versehentlich die Treppe hinuntergeschubst hat. Seine Klassenkameradin Huang Ling (Uvin Wang) leidet unter dem romantischen Verhältnis zu ihrem Lehrer. Der Kleinganove Yu Cheng (Yu Zhang) betrügt seinen besten Freund und trägt dadurch eine Mitschuld an dessen Freitod. Der alte Wang Jin (Congxi Li) soll von seiner Familie ins Heim abgeschoben werden, weil der Wohnraum zu eng wird. Dramatische Einzelschicksale, sinnbildlich für ein Land.
An Elephant Sitting Still nimmt das tragische Schicksal seines Regisseurs auf schmerzliche Weise vorweg. Kurz nach der Fertigstellung seines ersten und einzigen Films nahm sich Hu Bo das Leben. Er hinterlässt uns einen Film, der einem Lebenswerk gleichkommt. Einen vierstündigen Koloss, grau in grau. Angefüllt mit Kälte, durchtränkt von Melancholie. Vielleicht ein Hilfeschrei, der uns nicht rechtzeitig erreicht hat, vielleicht eine Form von Selbsttherapie, die letzten Endes doch gescheitert ist. Auch das kann Kunst, scheitern. Es ist vielleicht wenig gewinnbringend den Hintergrund eines Regisseurs auf dessen Film zu projizieren, doch in diesem Fall ist es unabdingbar. Beinahe erweckt An Elephant Sitting Still den Eindruck, er wäre niemals für ein Publikum gedreht worden. Ganz so als wäre er eine reine Bestandsaufnahme von Hu Bos Innenleben, als wäre jede der fein ausgearbeiteten Figuren ein Teil von ihm.
Allgegenwärtig ist der ökonomische Untergang, der soziale Abstieg spürbar. Gebäude werden abgerissen, Schulen müssen schließen. Die Familie wird zum reinen Konstrukt, einer Zwangsgemeinschaft ohne Liebe. Einen Schuldigen benennt Hu Bo nie und dennoch ist An Elephant Sitting Still auch ein Film über die chinesische Gesellschaft. Existentielle Ängste sind längst einer inneren Leere gewichen, die sich zusehends einer Todessehnsucht annähert. Es ist die Gewohnheit, die ihre Leben vorantreibt und der Einschnitt in diese Gewohnheit, der ihnen die eigene Bedeutungslosigkeit vor Augen führt. Durch seine langsam treibende Inszenierung überträgt der Film dieses lähmende Gefühl der Hoffnungslosigkeit auf den Zuschauer. Oftmals sind es ebenjene Einstellungen, in denen vordergründig nichts passiert, die am meisten schmerzen. Eine Welt im Stillstand, betäubt durch den gewaltigen Schmerz der eigenen Existenz.
Über vier Stunden verästelt Hu Bo sein komplexes Figurenkabinett immer mehr. Die Erzählstruktur baut Querverweise und indirekte Bezüge, bestimmte Momente werden aus mehreren Perspektiven gezeigt. Sind alle Figuren zunächst in ihrem eigenen Selbst gefangen, so nähern sie sich gegen Ende immer mehr an. Sie sind verbunden in ihrem Leid, ihrer Schuld. Beinahe scheint es so, als wäre jeder Charakter zwischen unsichtbaren Glaswänden eingesperrt, die zwar Blicke und Geräusche durchlassen, an der jedoch jede Form von Gefühl gnadenlos abprallt. Die Kamera folgt indes ihren Figuren, blickt ihnen manchmal über die Schulter, manchmal ins Gesicht. Fast immer stehen sie im Zentrum des Bilds, weil alles andere verschwimmt. Auch das ist ihr Blick auf die Welt, wie durch einen Schleier.
An Elephant Sitting Still wird dabei zu einem Film, der seinen Zuschauern alles abverlangt. Ein Film, der seine seelische Tristesse bis zum Körperlichen ausreizt. Und doch erweist sich Hu Bo nicht als Menschenfeind. Er zeichnet die Menschen so, wie er sich selbst sieht – als Opfer der Umwelt. Eine Gesellschaft, die zweifelsohne von Menschenhand geschaffen wurde, an welcher der Einzelne jedoch keine Schuld trägt. Das macht An Elephant Sitting Still nicht weniger pessimistisch oder erträglich, sondern nur direkter und eindringlicher. Hu Bo ist kein Regisseur, der von außerhalb auf das System blickt, der etwas vortäuschen muss. Vielmehr ist er ebenso wie die Figuren selbst darin gefangen. Letztlich gibt es keine Flucht, weder an einen anderen Ort noch aus dem Leben selbst. Der Hoffnungsschimmer, ebenjener titelgebende Elefant, wird zum gemeinsamen Ziel. Hoffnung gibt es keine, doch die Gemeinschaft macht die Hölle auf Erden erträglich.