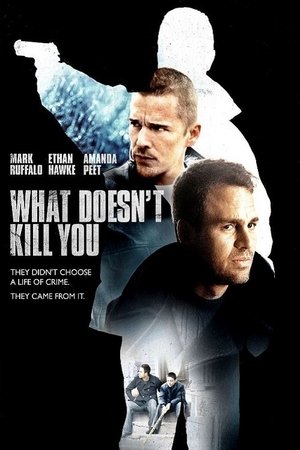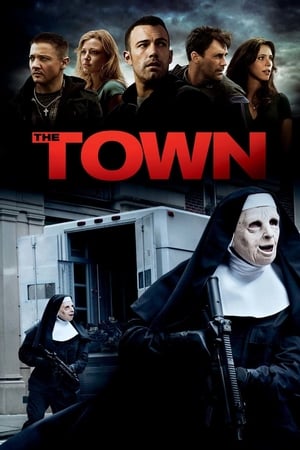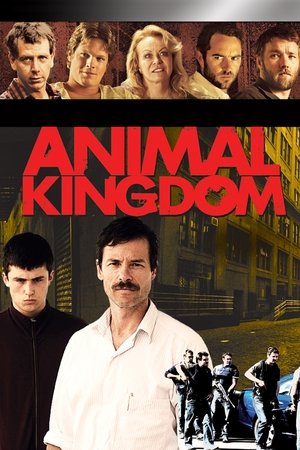Kritik
Dass Brian Goodman angab, als Regisseur und Drehbuchautor mit "Boston Streets" eigene Erlebnisse zu verarbeiten, spricht fast für sich selbst. Das Crimedrama will authentisch sein und bringt daher viele entsprechende Elemente mit hinein, was das Potenzial mitbrachte, als Milieustudie für Aufregung sorgen zu können.
In seinem Storyaufbau, den Figuren und den gezeigten Ereignissen kann man dem Film einen durchaus realistischen Charakter anpinnen. Die Bandenstruktur wirkt nicht überladen, die Charaktere sind mal mehr, mal weniger relevant aufgezeigt worden und die Dynamik hat keinen naiv-überdrehten Hollywoodanstrich. Fast wichtiger war es, bei seinen Protagonisten zu bleiben, wodurch zwei Identifikationsfiguren entstanden sind, die man trotz ihrer kriminellen Energie schnell gern haben mag. Leider strengt dieses Beiwohnen durch die hohe Dialogdichte sehr an. Etwas lose weiterführend, muss man - vor allem in der ersten Spielzeithälfte - oft viel Geschwafel an unterschiedlichen Locations ertragen. Das ist zwar eine nette Herausforderung für die Figurenentwicklung, aber für den Zuschauer weniger sinnvoll gestaltet worden, so dass gar die erzählerische Dynamik ziemlich auf der Strecke bleibt.
Zum Glück hält dieses Manko nicht den ganzen Film stand. Mit dem Knastaufenthalt wird auch die persönliche Note etwas mehr in den Vordergrund geschoben und endlich einer der beiden Hauptfiguren zum alleinigen Aufhänger auserkoren, was der Story auch plötzlich die nötige Dramatik und ein formelles Ziel verpasst. Mit Brian und seiner familiären Situation bewegt sich der Film dann auch in den Gefilden, die realistisch, mitfühlend und spannend erscheinen. Brian muss für etwas kämpfen, mit einer Familie im Schlepptau, findet gar die richtigen Anstöße, um dem Film letztlich eine angemessene Zuspitzung für das seichte Finale zu verpassen. Lediglich den Bogen zur Eingangssequenz des Streifens wird man wohl etwas verärgert zur Kenntnis nehmen müssen.
Leider sorgt vor allem die Inszenierung dafür, dass der Film allgemein betrachtet nicht aus dem Mittelmaß heraus kommt. Die Schnitte wirken hastig gesetzt und teils unsinnig, verbreiten jedenfalls kein Gefühl von Intensität. Die Kameraarbeit kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Stab die Routine und das gewisse Auge für die richtigen Momente fehlt. Alles geht höchstens noch als leicht dokumentarisches Begleiten durch, doch vermisst man schmerzlich aussagekräftige Motive, und so wurden reihenweise die Möglichkeiten liegen gelassen.
Auch nicht durchgängig überzeugen kann der Cast, auch wenn man solche Schwergewichte wie Ethan Hawke, Mark Ruffalo oder Amanda Peet verpflichten konnte. Die machen den FIlm auch sehenswert (gerade Ruffalo wird im Verlauf zum Hingucker durch seine Rollengestaltung), sehr leicht und nicht überheblich ordnen sich die Akteure der Geschichte unter. Doch in den Nebenrollen hätte der ein oder andere Routinist dem Film besser gestanden. Zwar gibt es eigentlich keinen Ausfall zu beklagen (außer in der deutschen Synchro, die teils ziemlich grottig klingt), doch fällt auch niemand positiv aus dem Rahmen. Hier hätte die ein oder andere Regieanweisung Wunder gewirkt.
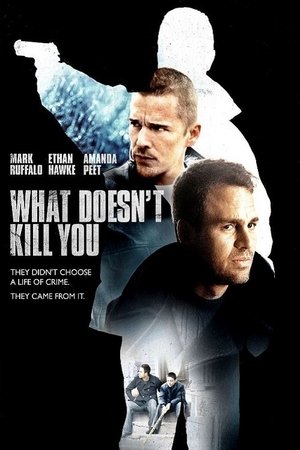 Trailer
Trailer