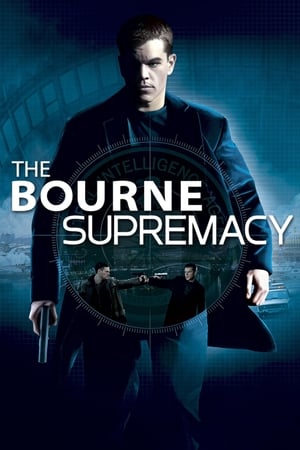Längst hat sich der ehemalige Journalist des britischen Fernsehens Paul Greengrass im Filmgeschäft etabliert, die brisanten Gefilden seines einstigen Reportage-Magazins World in Action aber verließ er nie und die Wortmarke dieses symptomatischen Titels wurde zum Ausdruck auf Greengrass' Agenda in der Kinematographie. Mit der säuberlich recherchierten Semidoku Bloody Sunday über den irischen Blutsonntag von 1972 oder der ebenso semidokumentarischen Rekonstruktion der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die World Trade Center in Flug 93, bahnte sich dieser engagierte Trend im Schaffen des Engländers seinen Weg, um in der Agenten-Quadrilogie um Jason Bourne neue Blickwinkel verliehen zu bekommen: Politische Beschaffenheiten und globale Verzahnung aber waren stets Motive des Kinos von Paul Greengrass, die mal mehr, mal weniger gelungen in Szene gesetzt wurden – Echte Seichtheit jedoch konnte man dem Mann wohl nie vorwerfen. Es sollte allerdings bis zum Jahre 2013 dauern, bis Paul Greengrass nicht nur seinen charakteristischen Stil perfektionierte, sondern auch die inhaltliche Ebene gekonnt wie nie auszuloten wusste.
Mit Captain Phillips nämlich erwartet den Zuschauer nicht nur die stur-zweckmäßige Aufbereitung des Piratenangriffs auf das Containerschiff Maersk Alabama, Greengrass hat hier zeitgleich intelligentes Hochspannungskino der Extraklasse inszeniert. Gleich zu Beginn legt Greengrass anhand einer pulsierenden Montage die geopolitischen Scheitelpunkte fest: Während sich Richard Phillips (Tom Hanks, Inferno), Kapitän des US-amerikanischen Containerschiffs Maerks Alabama, von seinem gesitteten Vorstadtidyll in Vermont auf den Weg zur Arbeit macht, streifen die ausgemergelten Körper an der somalischen Küste umher und suchen irgendwo Arbeit. Handelsübliche Fischer wie zum Beispiel Muse, gespielt von Branchenneuling Barkhad Abdi, finden sich alsbald in der Rolle gefürchteter Piraten wieder und machen das Gebiet um das Horn von Afrika unsicher, um Schiffe zu kentern und Lösegelder einzustreichen. Nachdem diese Weichen gestellt wurden, wird relativ schnell deutlich, dass Captain Phillips nicht daran interessiert ist, die Geschichte, die Welten, die Figuren in moralische Segmente einzugliedern: Muse und seine Gefährten hatten keine andere Wahl, weil ihnen die Existenzgrundlage bis auf Weiteres gnadenlos entrissen wurde.
Bemerkenswert am pointierten Drehbuch von Billy Ray ist, wie konkret, aber niemals verurteilend mit den Charakteren umgegangen wird. Die Piraten werden zu keinem Zeitpunkt dämonisiert oder fungieren nur als durchtriebene Antagonisten, während Phillips als strahlender Held aus der ganzen Sache am Ende hervorgehen darf. Captain Phillips kennt in dieser Hinsicht keine stilisierten Helden. Er (be-)kennt hingegen Menschlichkeit, und der letztendliche, vom Weißen Haus autorisierte Triumph durch die exekutiven Mittel der Seals geht einher mit einer bitteren Tragödie. Dabei lebt Captain Phillips vor allem von der Greifbarkeit der Emotionen innerhalb der thematisierten Extremsituation, die von der Überforderung zur Entschlossenheit, von Angst zur puren Willensstärke und von der Hysterie, der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit zurück zur letzten Standhaftigkeit umherspringen. Ihre ökonomischen Differenzen indes sind nicht von der Hand zu weisen, hier kollidieren zwei Welten. Phillips und Muse begegnen sich – auch wenn der Titel anderes vermuten lassen möchte – dennoch auf Augenhöhe, und die Verdeutlichung der Lebens- und Arbeitsumstände, der Machtverhältnisse innerhalb dieser, von Metaphorik wiederholt unterstützen, globalen Verkettung, entlädt Captain Philipps auf einer ethischen Linie.
Liegen die Kategorisierungen von Gut und Böse immer in den Grundlagen des Rechtssystems begraben oder zuweilen doch auch im Auge des Betrachters? Woran ist die Effizienz und Ineffizienz im Handeln der Beteiligten nun wirklich auszumachen? Captain Phillips steht für ergreifenden Existenzialismus auf hoher See, Anspannung durchbebt nicht nur die Körper der Protagonisten, denn Paul Greengrass lässt seinem Film durchgehend das Wahrhaftige, in dem er seine innig geliebte Shaky-Cam nicht über die Handlung ordnet, er bestimmt sie zum erzählerischen Mittel, die die Narrative unterstreicht, intensiviert, anstatt sie in ihrer Dynamik leichtfertig zu erdrücken.Dieses ungemeine Gefühl für Räumlichkeiten, die klaustrophobische Enge der Gänge, die beinahe transzendenten Weiten des Meeres sind derart atmosphärischen und faszinierend fixiert, dass es für den Zuschauer ein Unmögliches wird, sich dem Fotografien zu entreißen. „Captain Phillips“ ist über seine Laufzeit dabei so sensitive in seiner Bildsprache, so fühlbar in seiner Charakterisierung, und weiß die pseudo-dokumentarischen Anleihen brillant in das dramatisch-explosive Geschehen einzuweben.