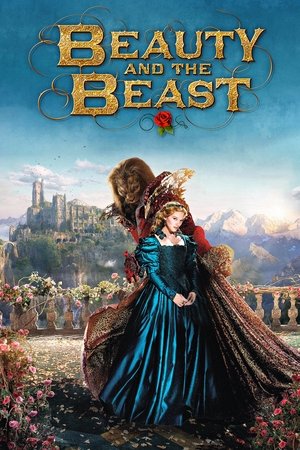Zuletzt hat Robert Stromberg mit„Maleficent – Die dunkle Fee“, einer perspektivisch etwas sanierten Version von „Dornröschen“, hauptsächlich durch gute Ansätze geglänzt. Doch egal wie schwer „Maleficent – Die dunkle Fee“ nach seinem stimmungsvollen Opening auch zusammengebrochen ist, Stromberg hat wieder eine Düsternis mit dem Märchen-Sujet verknüpft, die zuvor vollkommen verloren geglaubt schien. Im gleichen Monat diesen Jahres lief neben „Maleficent – Die dunkle Fee“ noch ein weiteres Märchen in den Lichtspielhäusern: „Die Schöne und das Biest“. Eine Geschichte, beruhend auf französischer Folklore, und bereits mehrfach literarisch und filmisch aufbereitet, natürlich auch äußerst erfolgreich von Walt Disney Anfang der 1990er Jahre. Wer also nur noch müde gähnen kann, wenn er „Die Schöne und das Biest“ hört, dem sei gesagt, dass in dieser Fassung von 2014 ein gewisser Christophe Gans auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Genau der Mann, der mit„Der Pakt der Wölfe“ 2001 ein unglaublich stylisches Fantasy-Kleinod inszenierte.
Christophe Gans wollte mit „Der Pakt der Wölfe“ der Welt auch deutlich machen, dass es immer noch großes, europäisches Kino zu bewundern gibt, das sich in seiner hochgestimmten Vision von Phantastik nicht vor der Traumfabrik verstecken muss. Fünf Jahre später entstand unter seiner Ägide„Silent Hill“, die wohl beste Game-Verfilmung, die bisher das Licht der Welt erblicken durfte. Doch seitdem wurde es still um den Franzosen. Es sollten also ganze acht Jahre vergehen, bis sich Christophe Gans zurück auf der Bildfläche melden würde – Und dieses Mal eben mit besagtem Märchen. Seiner Motivation, gerade „Die Schöne und das Biest“ zu verfilmen, kann man wohl nur mit einem Schmunzeln begegnen. Nachdem sich Gans nämlich Rupert Sanders Blockbuster „Snow White and the Huntsman“im Kino angesehen hat und verschreckt wie enttäuscht feststellen musste, dass der Geist des Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ vollkommen abhanden gekommen ist und Kristen Stewartvielmehr in Form von Jeanne d'Arc aufgetreten ist, wollte er dieser Entmystifizierung entgegenhalten – Mit mäßigem Erfolg.
Es wäre müßig an dieser Stelle zu erwähnen, dass „Die Schöne und das Biest“ durchaus besser als „Snow White and the Huntsman“ geraten ist – Was heißt das schon? Nicht viel. Wenn wir uns die Intention von Gans noch einmal zur Brust nehmen und seinem Anliegen, das Märchenhafte zurück in die Lichtspielhäuser zu bringen, pedantisch nachspüren, wird schnell ersichtlich, dass genau dieser Versuch rigoros in die Hose gegangen ist. „Die Schöne und das Biest“ ist fernab dem einnehmend phantastischen Flair, wie man es sich wohl innig gewünscht hat, stattdessen verfällt Christophe Gans der von Computereffekten überladenden Seelenlosigkeit. Das reiche, prunkvolle Dekor, die herrlich eingefangenen In- und Exterieurs, das verwunschene Märchenschloss, mit seinen Brunnen und Brücken, umrankt von buntem Gewächs, all das funktioniert nur auf den ersten Blick, bis zum nächsten Wimpernschlag. Der zweite Blick fällt der Künstlichkeit zum Opfer und all die potenziellen Schauwerte entzücken nicht, sie animieren viel mehr dazu, den Blick abzuwenden, weil die an zeitgenössische Gemälde orientierte Visualität letztlich nur auf einem abstoßend artifiziellen Plateau basiert.
Man kauft Christophe Gans durchaus ab, dass ihn ein Interesse am Sagenhaften katalytisch angetrieben hat, doch selbst seine Aufnahmen des ornamentiertes Barock besitzen eine fragile Halbwertszeit, wie der Anblick des Biestes – Natürlich ebenfalls dem Hochleistungsrechner entsprungen und via Motion-Capture-Technik aufbereitet. Dass dahinter allerdings eine so toller Charakter-Darsteller wie Vincent Cassel(„Eine dunkle Begierde“) stecken soll, wird maximal in die Rückblenden ersichtlich, wenn Cassel dann auch in seiner menschlichen Form durch den Greenbox huschen darf. Die durch ihre Natürlichkeit immer wieder bezaubernde Léa Seydoux („Blauist eine warme Farbe“) ist in der Rolle der Schönen zwar bestens aufgenommen und Gans kann sich an seinem blühenden Starlett wahrlich nicht sattsehen, so vehement er sich an ihren Lippen festsaugt, doch auch ihre Figur bleibt ein Produkt vom Reißbrett. Allgemein artikuliert sich „Die Schöne und das Biest“ über sterile Konturen, seine Opulenz ist Attitüde, seine Charaktere nur schale Gefäße; Hüllen, die eine gar beißende Leere aufweisen, wo eigentlich ein starkes Herz zur Materie eine sinfonische Melodie pochen sollte. „Die Schöne das Biest“ kein spielerisch-schwelgerischer Film, sondern ein leerer Krampf.
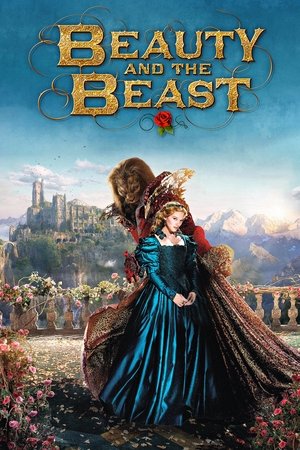 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org