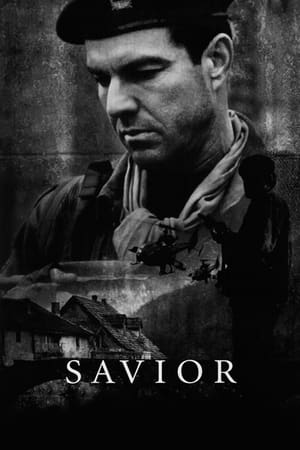Bei der Oscarverleihung 2012 räumte der Franzose Michel Hazanavicius mit seinem Stummfilm The Artist mächtig ab. 5 Goldjungen, darunter den für den besten Film, wurden ihm zu Teil und der Mann, der zuvor nur durch seine Spionageblödeleien OSS 117 – Der Spion, der sich liebte und den Nachfolger OSS 117 – Er selbst ist sich genug mehr oder (eher) weniger auf sich aufmerksam machte, plötzlich weltberühmt. Dies dürfte tendenziell wohl der Zenit seines Erfolges gewesen sein, denn dass wirklich ernste, sogar wichtige Thematiken mindestens eine Hürde zu hoch für ihn sind beweist er unfreiwillig mit Die Suche.
1999, kurz nachdem Boris Jelzin Wladimir Putin zum Premierminister Russlands ernannte, bestand einer ihrer ersten, gemeinsamen Amtshandlung darin, die Invasion in Tschetschenin nach drei Jahren Waffenstillstand wieder aufleben zu lassen. Begründet mit Anschlägen in Moskau und somit offiziell als eine Anti-Terror-Aktion verkauft. Der erste von bis heute zahlreichen Schandflecken in der Ära Putin, dessen grausame Tatsachen einen besseren Film verdient hätten – ach was, hätten bekommen müssen – als dieser sicher gut gemeinte, aber in seiner Umsetzung fast kläglich gescheiterte Versuch von Hazanavicius als ernstzunehmender Regisseur wahrgenommen zu werden. Die Tragödie eines barbarischen Raubzugs einer Weltmacht gegen ihren wehrlosen, unbeachteten kleinen Bruder wird anhand von zwei Storylines vorgetragen, die erst gegen Ende einen Überschneidungspunkt finden. Die eines Jungen, der die Ermordung seiner Eltern mitansehen muss und als Straßenkind in der Obhut einer UN-Mitarbeiterin (Bérénice Bejo, Ritter aus Leidenschaft) landet, und der eines 19jährigen Russen, der wegen eines kleinen Drogendeliktes die Wahl hat zwischen Knast und Wehrdienst. Er entscheidet sich für Letzteres und verliert nach und nach während der brutalen Zeit seine Menschlichkeit, bis aus einem anständigen, jungen Mann eine perverse Bestie geworden ist.
Das klingt theoretisch alles gar nicht schlecht, ist leider bald unfähig vorgetragen. Formell, rein auf das Drumherum konzentriert, ist Die Suche auch durchaus in Ordnung. Hazanavicius vermeidet großen Pathos, besetzt bis auf Hauptdarstellerin Bejo und die in einer Nebenrolle auftretende Annette Benning (Bugsy) seinen Film mit unbekannten, authentisch wirkenden Gesichtern. Zeigt das Grauen des Krieges auf, ohne es plakativ darstellen zu müssen (wer das radikale Gegenbeispiel sehen will, mal in den angeblich so wichtigen Darfur – Der vergessene Krieg von Arthaus-Ikone Dr. Uwe Boll reinschauen), gleichzeitig gelingt ihm aber auch kaum eine vernünftige, tiefere Bindung zu seinen Figuren. Die titelgebende Familienzusammenführung (der Film bezieht sich dabei inhaltlich auf den 1948 gedrehten Die Gezeichneten, im Original wie hier mit The Search betitelt) ist ein träges, trockenes Brot, arm an Highlights und greifbaren Emotionen, obwohl Potenzial reichlich vorhanden ist. Da springt nie der Funke über, da werden nicht diese kleinen Momente erzeugt, an denen der Zuschauer endlich einen echten, empathischen Zugang zum Geschehen findet, der über das Offensichtliche, das nüchtern Dargestellte hinausgeht.
Die parallel gezeigte Handlung ist dabei das größere Übel. Das sich ein Film, der aus Opferperspektive erzählt wird (bei einem unbestreitbar grausamen, menschenverachtenden Kriegsakt), nicht unbedingt differenziert betrachten lässt, einverstanden. Mit der Story des unfreiwilligen Soldaten wäre die Chance aber durchaus gegeben. Die ganze Mission ist verwerflich, das muss aber doch nicht zwangsläufig heißen, dass die russische Armee vom leitenden Offizier bis zum kleinsten Fußsoldaten nur aus sadistischen, abgestumpften Wilden besteht. Das man dort unweigerlich irgendwann als kleiner Fisch die noch kleineren Fische fressen muss und selbst zum Tier wird. Dies ist weder glaubwürdig, es wird schon gar nicht - zumindest in diesem gezeigten Einzelfall - irgendwie nachvollziehbar vorgetragen. Unabhängig davon, wie schlimm das Gesamte unbestreitbar war, alles und jeden mehr oder weniger über einen Kamm zu scheren ist auch keine Heldentat. Im Gegenteil, der Film wirkt dadurch massiv einseitig, bald fahrlässig zur Propaganda aufgeblasen, obwohl er doch das Richtige will. Geht es nur plump an, und das sollte bei der Thematik unbedingt vermieden werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass Die Suche – obwohl nach einem schwachen Feedback bei seiner Premiere noch deutlich gekürzt – mit immer noch 135 Minuten viel, viel zu lang geraten ist. Der Film hat überhaupt nicht genug relevante Szenen, um diese Länge zu rechtfertigen. Oftmals tritt er einfach auf der Stelle und rückwirkend betrachtet hätten es 100 Minuten auch locker getan, den erzählerischen Fluss deutlich besser gemacht. Inhaltlich natürlich nicht entscheidend.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org