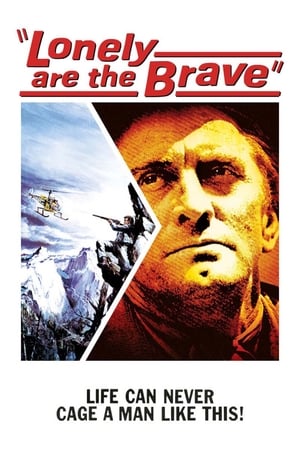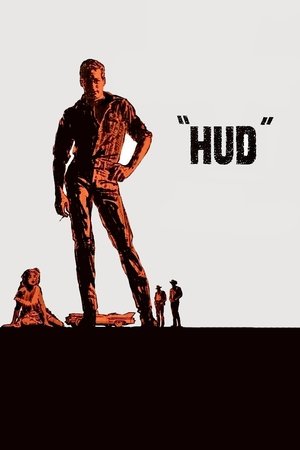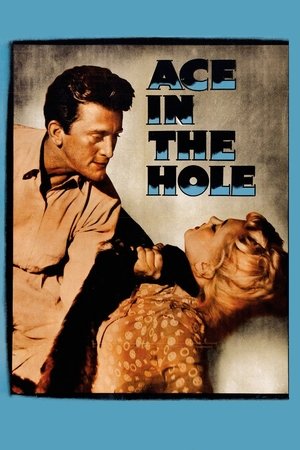Um sich vor der Sonne zu schützen, hat sich der im Bergland des amerikanischen Südwesten rastende Jack (Kirk Douglas, Reporter des Satans) den Hut tief ins Gesicht gezogen. Aus dem Mundwinkel qualmt eine Zigarette entspannt vor sich hin. Es sind Minuten der Einkehr, der Sehnsucht, nicht nur für den Hauptdarsteller, sondern auch für den Zuschauer, der durch die Bilder mit einer dem klassischen Western entnommenen Cowboy-Romantik konfrontiert wird. Genau diese Romantik jedoch findet nach wenigen Sekunden ihr jähes Ende, wenn Jack, sein Pferd und gewissermaßen auch der Zuschauer vom Getöse dreier vorübersausender Düsenflugzeuge aus der Erholungspose gerissen werden. Wo Einsam sind die Tapferen zu Anfang noch den Eindruck erweckte, sich dem Western auf traditionelle Art und Weise zu nähern, wird hier bereits mehr als deutlich gemacht, worum es David Miller (Mitternachtsspitzen) wirklich geht: Um die Auflösung dessen.
Im Zentrum steht ein folgenschwerer Zusammenprall der Kulturen und Lebensentwürfe. Jack, der den Wilden Westen selber niemals erfahren hat, fühlt sich der Mentalität der Cowboys hingezogen: Er will das Land, durch welches er zieht, nicht besitzen, aber möchte es kennenlernen, bevor er keine Chance mehr dazu hat. Ihm gegenüber steht eine moderne Gesellschaft, die auf Leistung, Konsum und damit auf Anonymität aufgebaut hat. Der Einzelne muss sich dem System unterordnen, er darf diesem nicht entfliehen. Einsam sind die Tapferen erforscht und betont anhand der (fast musealen) Figur des Jack Burns die Unmöglichkeit des Individualismus innerhalb einem emotional weitestgehend vergletscherten Hierarchiegebildes. Dass Jack niemandem etwas tun möchte, steht außer Frage. Sein archaischer Lebensstil aber stößt einem bürokratischen Gefüge, welches darauf ausgelegt ist, Menschen gnadenlos durchzustrukturieren, sauer auf. Erinnerungen an den Sylvester-Stallone-Klassiker Rambo werden wach.
Und sicherlich bildet Einsam sind die Tapferen eines der großen Vorbilder für den zu Unrecht zum reißerischen 1980er Jahre Unikat erhobenen Rambo, findet sich Jack Burns doch in der gleichen Rolle wieder, wie einst der seelisch versehrte Vietnamveteran: Er muss kämpfen, obwohl er dem Kämpfen (eigentlich) abgeschworen hat. An die Fersen des letzten Cowboys heftet sich Sheriff Johnson (Walter Matthau, Ein seltsamer Paar), nachdem Jack aus dem Gefängnis ausgebrochen ist – in das er sich für seinen besten Freund durch eine zünftige Kneipenschlägerei gezielt manövriert hat. Johnson jedoch ist nicht das Abziehbild eines wutschnaubenden Gerechtigkeitsfanatikers, sondern, ähnlich wie Jack, ein Opfer seiner Umwelt. Man liest es Johnson in seinem Gesicht ab, dass in ihm eine gewisse Bewunderung für den aus der Zeit gefallenen Jack Bahn bricht. Für seinen freiheitsliebenden Mut, sich den modernen Gesetzen zu widersetzen.
Als Zuschauer fiebert man selbstverständlich mit Jack, hofft, dass ihm die Flucht doch irgendwo gelingen mag, um seinen Traum vom ungebundenen Leben erfüllen zu können. Einsam sind die Tapferen allerdings kehrt ohne Ausflüchte zur entlarvenden Taktung zurück, die uns bereits die Cowboy-Romantik in der Exposition madig gemacht hat, um die Illusion vom Wilden Westen endgültig zu unterminieren. Jack, den Kirk Douglas gewohnt mit verletzlicher Markanz verkörpert, ist ein fleischgewordener Anachronismus; ein Cowboy, der sich im Jahrhundert verirrt hat – und unter fassungslosen, resignativen Blicken seine eigene Vergänglichkeit und Endlichkeit begreifen muss. In symbolträchtigen Fotografien wird Einsam sind die Tapferen zur tieftraurigen Tragödie eines Mannes, der frei sein wollte, aber nicht verstand, dass die Freiheit ein Mythos ist, der im blutgetränkten Boden der Westen vergraben liegt. Kein letztes Aufbäumen, nur ein letztes Mal die Hoffnung derer nehmen, die tatsächlich dem Glauben an ein Land unbegrenzten Möglichkeiten erlagen.
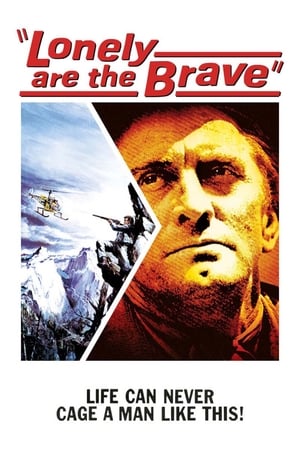 Trailer
Trailer