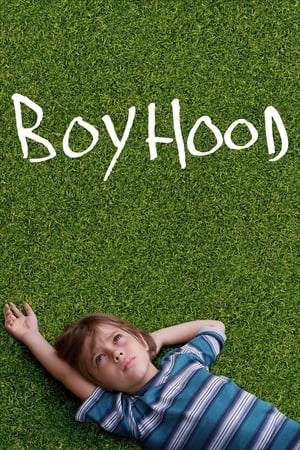Am Ende bestätigt ein Schriftzug das, was der Film zuvor über gut 110 Minuten bisweilen mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht haben: Viggo Mortensen (Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs) hat Falling, sein Debütwerk, seinen Eltern gewidmet. Eine Herzensangelegenheit also, ein Passionsprojekt, möchte man meinen, welches mit dieser letzten Widmung kurz vor dem Abspann einen außerordentlich bitteren Beigeschmack bereithält. Unweigerlich stellt man sich als Zuschauer damit nicht die Frage, was das eigentlich für Personen waren, in deren Schoß Viggo Mortensen aufgewachsen ist. Man fragt sich auch, was das überhaupt für ein Bild ist, welches der dreifach Oscar-nominierte Ausnahmedarsteller von seinen Eltern hier auf die Leinwand getragen hat. Definitiv ein schwieriges, so viel steht einmal fast. Schwierig, was sich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne verstehen lässt.
In einem Interview hat Viggo Mortensen diesen biographischen Rahmen dann ein Stück weit relativiert. Ja, Falling weist durchaus Bezüge hinsichtlich der eigenen Vita des Regisseurs, Drehbuchautors und Hauptdarsteller auf, es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine autobiographische Auseinandersetzung. Stattdessen geht es in Falling darum, den Kern von dysfunktionalen Familienverhältnissen sichtbar zu machen, wenn diese letztlich nicht selten auf das trügerische Konzept von Erinnerungen zurückgeführt werden. Die Vergangenheit ist auch in Viggo Mortensens Leinwandvision eine Geschichte, die sich die Protagonisten auf ihre subjektive Art und Weise erzählen. Das Problem dabei ist, dass Mortensen sein psychologisches Dilemma etwas zu einfach denkt und einen Vater-Sohn-Konflikt in den Fokus nimmt, der über die meiste Zeit der Handlung überraschend eindimensional ausfällt. Kraftvoll ist der Film dennoch.
Dem autoritäre Willis (Lance Henriksen, Aliens - Die Rückkehr) bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich die ohnehin schon verblasste Vergangenheit (und damit auch die Geschichten, die seine Identität stiften) in Luft auflösen. Seine Demenzerkrankung schreitet gnadenlos voran, und wie es scheint, schwemmt sie vor allem das Schlechteste in ihm auf seine alten Tage unentwegt an die Oberfläche. Seinen Jähzorn, seinen Selbsthass, seine Ressentiments gegenüber Frauen, Homosexuellen, Ausländern. Willis hasst die Welt und er scheut sich nicht davor, diese brodelnde Abneigung permanent nach außen zu brüllen. Vor allem in Richtung seines Sohnes John (Mortensen), der mit seinem Partner ein Kind adaptiert hat und sich schon vor Jahrzehnten von seinem Vater entfremdete. Das Zerwürfnis bleib natürlich ohne verbale Konfrontation. Man nimmt den unausstehlichen alten Sack eben so hin, wie er ist.
Falling springt dabei immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her und versucht aufzuspüren, wann sich der Bruch zwischen Willis und John genau zugetragen hat. Das Schöne dabei ist, dass es Viggo Mortensen durchaus gelingt, die Ambivalenz von (gemeinsamen) Erinnerungen aufzeigen, anstatt sich nur auf das Ringen zwiscen Tradition und Moderne, Fort- und Rückschritt zu konzentrieren. Natürlich kollidieren hier Lebensentwürfen respektive Generationen, die auch einen Einblick in das Herz eines von Vorurteilen belasteten (Provinz-)Amerikas verdeutlichen. Die ätzende Intensität, die sich aus dem gelungenen Zusammenspiel zwischen Viggo Mortensen und Lance Henriksen ergibt, aber stellt vielmehr die spannende Frage, ob es reicht, Emotionen noch einmal zu teilen, um Verletzungen vergessen zu machen. Muss man seinem Vater wirklich vergeben? Lindert eine Aussprache immer den Schmerz? Wohl kaum.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org