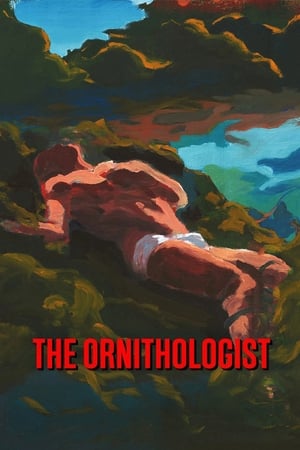Blickt man auf das Jahr 2022 zurück, so scheint sich eine Tendenz, die sich in der Literatur schon seit geraumer Zeit abzeichnet, nun auch zunehmend im Festivalkino zu verdichten: Die essayistische Form ist auf dem Vormarsch. Zu nennen wäre da der weitgehend ungesehene The Last Days of Humanity der Italiener Alessandro Gagliardo und Enrico Ghezzi, der, seinem an die Endzeitstimmung der 1990er Jahre erinnernden Titel zum Trotz, nicht in der Fatalität endet, obgleich er uns in zahlreichen Momenten wiederholt gute Gründe liefert, in Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Doch statt uns mit dem unmittelbaren Grauen der jüngeren Menschheitsgeschichte direkt zu konfrontieren, überführen uns Gagliardo und Ghezzi wiederholt in einen Zustand des Danachs: So sind es nicht Videoaufzeichnungen von einem abermaligen Shooting im mittleren Westen der USA, sondern Beobachtungen der Trauerstätte im Nachgang, die von der distanzierten, wortwörtlich auf den Kopf gestellten Kamera eingefangen werden—Augenblicke, in denen die beiden Filmemacher auf die im Film geäußerte Frage reagieren, welche Momente oder Ereignisse überhaupt der Erinnerung wert seien.
Ebenfalls nicht dazu bereit, sich angesichts des omnipräsenten Krisenzustands unserer Gegenwart der Hoffnungslosigkeit zu ergeben, zeigte sich Bertrand Bonello auf der Berlinale 2022, dessen verspielter, in seinem formalen Ansatz schwer fasslicher Coma gleichsam dem vereinsamten, zunehmend parasozialen Leben zu Zeiten einer Pandemie Tribut zollte und sich zugleich offen ratlos als Gesprächsgesuch an seine Tochter und deren „letzte“ Generation wendet. Die Welt steht bei Bonello eingangs in Flammen, und wo das Scheitern nicht mehr von der Hand zu weisen ist, fokussiert sich alles auf den Versuch. Diese Einschreibung des Scheiterns an der Sache, die Unfertigkeit, steht paradigmatisch für eine Vielzahl von Gegenwartsnarrativen. Statt nach Ganzheitlichkeit zu streben, zerfransen die nurmehr in ihrer Fiktionalität zusammengehaltenen Geschichten zunehmend und verweben sich zu einem sporadisch-assoziativen Geflecht aus Bildern, Bonmots und Reflektionen.
In diese Reihe lässt sich nun auch João Pedro Rodrigues‘ Fogo-Fátuo (Irrlicht) einordnen. Angesiedelt im Jahr 2017 begegnen wir dem jugendliche Prinz Alfredo (Mauro Costa) zu Beginn des Films am Esstisch, während das Fernsehen uns nebenher von den Wildbränden berichtet, die Portugal in diesem Sommer heimsuchten—unter anderem im königlichen Kiefernwald. Wie uns Rodrigues nur wenige Minuten zuvor zeigte, war es eben dieser Wald, einst gepflanzt unter König Afonso III im 13. Jahrhundert, durch den Alfredo nur sechs Jahre zuvor mit seinem Onkel spazieren gegangen war und dessen stramme Stämme und saftig-grüne Nadeln in ihm dereinst ein Erweckungserlebnis ausgelöst hatten. Als Alfredo nun hört, wie seine von Rodrigues ins Karikatureske stilisierte Mutter in Reaktion auf die Naturkatastrophen mit großer Dankbarkeit auf das Pariser Klima-Abkommen verweist, erhebt sich Alfredo entschieden vom Esstisch und rezitiert die berühmt gewordenen Worte Greta Thunbergs während er in die Kamera spricht. Die vierte Wand muss bei Rodrigues nicht erst durchbrochen werden, da sie von Beginn an auf selbstverständliche Weise als inexistent markiert wird. Das Gezeigte ist immer bereits Theater, das die Figuren über die meiste Zeit hinweg bereit sind, zu vergessen, zu dem sie sich jedoch dann und wann wieder bekennen (so etwa, wenn die weiten Schiebetüren des royalen Anwesens auf- und zugezogen werden, um, wie mittels des Theatervorhangs, eine Szene abzuschließen oder zu eröffnen). Dies im Hinterkopf verwundert es auch nicht, wenn Alfredos aristokratische Mutter ihn zurechtweist, er solle die königliche Familie nicht mit dem Kino verwechseln. Darauf bedacht, sich durch diesen Metakommentar nicht den Stachel ziehen zu lassen, verkündet Alfredo entschlossen, bei der Feuerwehr anzuheuern, um den königlichen Wald zu beschützen.
Wer nur grundlegend mit Rodrigues‘ Werk vertraut ist, wird nicht weiterer Erklärungen für diese Grundkonstellation bedürfen, das Setting heiligt schließlich die Mittel. Das gilt zum einen für das Fortwähren der royalen Familie in der Gegenwart—die Monarchie endete in Portugal 1910 mit dem Coup d’État der republikanischen Partei Portugals, dem Höhepunkt der Revolution vom 5. Oktober—zum anderen aber insbesondere für den Schauplatz der Feuerwache. Sucht man Gründe für diese Entscheidung, die über die schlichte—doch gleichwohl unbestreitbare—Tatsache hinausgehen, dass die Feuerwehr seit jeher nicht nur tatsächliche Feuer gelöscht, sondern in ihren Bewunderer*innen auch flammendes Begehren entfacht hat, so findet Rodrigues zwei Rationalisierungsversuche. Einerseits haftet dem Beruf, der es sich zur Aufgabe macht, die Brände zu löschen, die, insbesondere im Zeitalter des Anthropozäns, immer zahlreicher—und verheerender—auflodern, eine nicht zufällige Symbolhaftigkeit an.
Gleichzeitig, so führte der portugiesische Filmemacher im Rahmen der Premiere seines siebten Spielfilmes bei den Filmfestspielen in Cannes an, habe ihn die Organisation der Feuerwehr an jene klassenverdampfende Einheit erinnert, die einmal durch die Wehrpflicht produziert worden sei. Bis 2003, als jener Zwang in Portugal ausgesetzt wurde, seien beim Militär alle gesellschaftlichen Klassen zusammengekommen und hätten so, in gewisser Weise, einen demokratischen Raum gebildet. Wer nun allzu schnell darauf bedacht ist, Zweifel an der utopisch-egalitären Kraft des Militärdienstes anzumerken, wird solche Bedenken nach der Sichtung Fogo-Fátuos nur allzu bereitwillig über Bord werfen, interessiert sich Rodrigues doch nur tangential für die politischen Implikationen. Statt des Versuchs, in dieses Milieu einzutauchen, bietet uns der ehemalige DAAD-Stipendiat Rodrigues ein Spiel mit der Symbolhaftigkeit der Welt, deren vorgefundene Zeichenhaftigkeit sich durch den Film verschieben lässt.
Klischees wird hier nicht versucht, aus dem Weg zu gehen, vielmehr ist es die kräftige Umarmung derer, aus der Rodrigues‘ seine kreative Kraft zieht. Themen werden auf diese Weise nicht durchdrungen, sondern überlaufen; in langen, schnellen Schritten umgeworfen. Die füllige Feuerwehrkommandantin etwa, die Alfredo aufsucht, um sich auf freiwilliger Basis der Brandwache anzuschließen, wird von Rodrigues ausschließlich in ihrer Zeichenhaftigkeit als Kontraintuition verstanden. Von all ihren jungen Feuerwehrmännern (in den deutschen Untertiteln) als Frau Hauptmann adressiert—man erinnere sich an das Jahr 2018, als die neue Berliner Polizeipräsidentin das Präsidium des „Präsidenten“ bezog—verkörpert diese buchstäblich ein Gegenbild zur gängigen Vorstellung eines athletischen Männerkörpers im Amt des Vorsitzes.
Nachdem sie dem schüchternen Alfredo etwas auf den Zahn fühlt, ruft sie, wenn auch nicht ohne Restskepsis, den verlässlichen Alfonso (André Cabral), um Alfredo in den Alltag auf der Wache einzuweisen. Wohl auch aufgrund der rasch vorbeifliegenden 67 Minuten Laufzeit verliert Rodrigues nun keine Zeit und setzt alles daran, dass sich die Intensität, die die beiden jungen Männer während ihrer ersten Begegnung verspüren, auf das Publikum überträgt. Individualpsychologisch ist die Begegnung zusätzlich durch die dunkle Hautfarbe Alfonsos aufgeladen, entstammt Alfredo doch einer Familie, die wie keine zweite in diesem fiktionalisierten Abbild Portugals den Kolonialismus und die Sklaverei verkörpert. Zu entkommen ist diesem Abbild, dieser automatischen Repräsentation, ohnehin nicht, denn selbst als Alfredo später den Wunsch äußert, „nichts“ zu sein, „für gar nichts“, da sehen wir im unteren Bildausschnitt die Spiegelung seines Gesichts auf der Wasseroberfläche. In der Folge kommen die beiden jungen Männer nun nicht mehr voneinander los. Doch glich Fogo-Fátuo bis dahin einer ausdruckslosen, bizarr-distanzierten Komödie, so entspringt der Einführung Alfonsos all das Leben, die Farbe, ja die Hitze, die es braucht, um die durch Rodrigues in den Opening Titles in Aussicht gestellte „musikalische Fantasie“ herbeizuführen.
Es ist eine durchaus exzentrische, doch nicht unzutreffende Genre-Beschreibung, die uns João Pedro Rodrigues hier unaufgefordert mit auf den Weg gibt, und vermutlich ist sie nur die konsequente Fortsetzung früherer Rodrigues-Filme, die noch mehr um Narration bemüht waren. Was sich bis zu diesem frühen Punkt der Geschichte andeutet, gerät nun zu einem bunten und insbesondere queeren Treiben, eine offene Form, innerhalb derer sich vignettenhaft ein Narrativ verwebt hin zu einem Ziel, das uns Rodrigues in der Eingangsszene als Zukunft des Jahres 2069 in Aussicht stellt. Bis es allerdings soweit kommt, interessiert sich Fogo-Fátuo insbesondere für die Theatralik seiner Geschichte, für den Moment, den die beiden jungen Männer aus diametral-entgegengesetzten Milieus miteinander verleben, aber auch für das Zurschaustellen und Darstellen dessen, woran wir uns gewöhnt haben und die Schwierigkeit, von solch festen Bildern loszukommen.
Spielerisch wird uns das auf institutioneller Ebene präsentiert, wenn wir zu Elektro-Pop die muskelbepackten Körper der Feuerwehrmänner sehen, die sich während eines Moments der Ruhe dem Beat hingeben—einem kollektiven Rhythmus, dem sich bald schon „Frau Hauptmann“ anschließt. Auf ähnliche Weise mit der Idee vorgefertigter Bilder spielend, führt Rudolfo Alfredo und gleichsam uns durch die Wache und reinszeniert mit seinen Kollegen auf denkbar explizite Weise die Werke großer Meister wie Rubens, Velázquez‘, Caravaggios oder Francis Bacons für einen erotischen Kalender auf denkbar explizite Weise. Angesichts der kurzen Laufzeit beweist Rodrigues mit dem Verzicht auf dramaturgische Zuspitzungen ein feines Gespür für die Tonalität seines Filmes. Die Fronten, so legt es Fogo-Fátuo nahe, sind ohnehin offenkundig, weshalb Rodrigues, statt sich zum Schein an diesen abzuarbeiten, lieber den Visionen einer Andersartigkeit unserer Gegenwart und Zukunft zuwendet, in denen der Augenblick größer ausstrahlt als ein gesponnenes Narrativ.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org