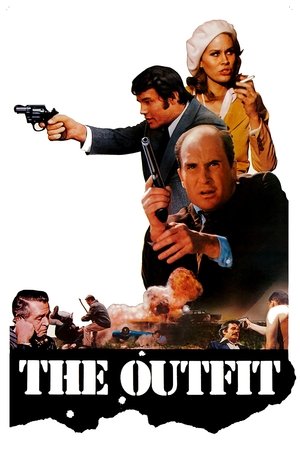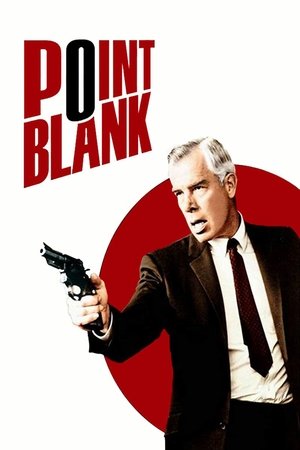„Sie sind ein großer Mann. Nur außer Form und kein Gegner für mich, also bleiben Sie sitzen!“
Die bemühte, gegen das eigene, veraltete Image anspielende, damalige Karteileiche Sylvester Stallone (Rambo, inzwischen durch geschicktere Rollenauswahlen halbwegs wieder rehabilitiert) schleudert diesen womöglich als ironische Anspielung angelegten Satz ausgerechnet Sir Michael Caine an den Kopf. Dem Star der ersten Verfilmung Jack rechnet ab aus dem Jahr 1971, einem wahren Klassiker des britischen Gangsterfilms. Dabei kann er selbst unter fairen oder wenigstens halbwegs realistischen, angepassten Bedingungen nur verlieren. So ist das eher eine hämische Demütigung; der eigene, vorweggenommene Genickbruch eines Remakes (oder „alternativen Romanadaption“), nach dem ohnehin niemand gefragt hätte und von seiner gesamten Daseinsberechtigung somit schon mal auf sehr dünnem Eis entlang schlittert.
Ein grimmiger, in seiner verbissenen Ernsthaftigkeit leider stocksteifer Sylvester Stallone wühlt sich wie einst Michael Caine als Jack Carter, einem Mann fürs Grobe in der Unterwelt, durch die selbige. Statt in England diesmal in den USA, der Grund bleibt identisch. Sein jüngerer Bruder kam angeblich bei einem Unfall ums Leben, was Carter nicht so recht glauben mag und deshalb anfängt, unangenehme Fragen bei den Leuten zu stellen, die es in der Regel nicht gerne haben, wenn man die Nasen in ihre Angelegenheiten steckt. Nur das Jack Carter niemand ist, dem man mit einem Klapps auf den Hintern wieder verjagen kann. Und wenn man härtere Bandagen auffährt unweigerlich Gefahr läuft, dass die unmissverständliche Gegenreaktion auf dem Fuße folgt. Bei der Story wird wenig verändert, einiges natürlich durch die Ortsverlagerung und die 30 Jahre Differenz logisch angepasst, grundsätzlich bleibt es aber die identische, pessimistische Vergeltungsgeschichte. Kann dann ja nicht viel schlechter sein? Oh doch, und wie, denn gerade im direkten Vergleich mit dem Original geht Get Carter – Die Wahrheit tut weh noch mehr baden, als ohne Kenntnisse der Vorlage ohnehin schon.
Während Jack rechnet ab mit seiner enormen, fettreduzierten Präzision, seiner Zielstrebigkeit, seiner radikalen Eiseskälte gleichwohl räudige, rohe Unbarmherzigkeit wie elegante, stilistisch prägende Coolness versprühte – was ihn heute noch zu einer echten Hausnummer macht – wirkt Get Carter – Die Wahrheit tut weh wie der behäbige, übergewichtige Cousin aus Amerika, dem trotz seiner angestrebten Bärbeißigkeit zwischendurch immer wieder die Füße einschlafen. Sly’s Carter ist keine unaufhaltsame Maschine wie einst Caine. Zwar ein wütender, aber noch mehr griesgrämiger Trauerkloß, den der neuseeländische Regisseur Stephen T. Kay (Boogeyman – Der schwarze Mann) nie konstant als vernünftige Bedrohung aufbauen kann, da er selbst viel zu beschäftigt damit erscheint, seinen Film künstlich auf cool zu trimmen. Seine entweder zappelig-überzogenen (John C. McGinley, Scrubs) oder desinteressiert-abwesenden Nebendarsteller (Mickey Rourke, The Wrestler, wie damals so oft komplett in seiner eigenen Welt) hat er dabei genau so wenig im Griff wie das Pacing, quetscht mal eine Autoverfolgungsjagd dazwischen, wenn auch ihm das wohl mal zufällig auffällt.
Bezeichnet, dass die Geschichte auch noch durch ein ödes, standardisiertes Ende ohne Ecken und Kanten zusätzlich an Bedeutungslosigkeit „gewinnt“, obwohl man ja auch ganz einfach das des Originals hätte übernehmen können, wie man es ja auch mit fast allem anderen machte. Das ist die große Anti-Kunst dieses Films: Nicht viel ändern, aber wenn dann bitte so falsch wie möglich. Als wenn es Absicht wäre. Der einzige, der hier noch fast den Tag retten könnte, ist (na so was) eben jener Original-Carter Michael Caine. In seinem Fast-Cameo mit gerade mal drei Auftritten ist er eigentlich der wahre Star des Films und kann einem doch fast leidtun, dass er in der verkorksten Aufwärmung einer seiner besten Rolle mitwirken darf. Und bewahrt genau dabei seine ganze Klasse, in dem er alles und jedem an in diesem Film die Show stiehlt, obwohl ihm dafür eigentlich gar nicht die Bühne gegeben wird. Das ist wirklich meisterlich.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org