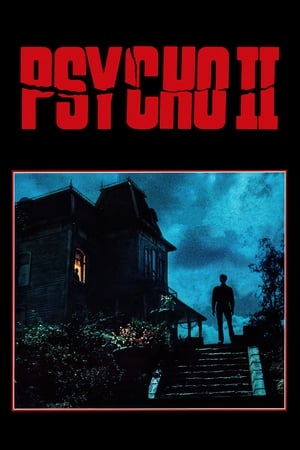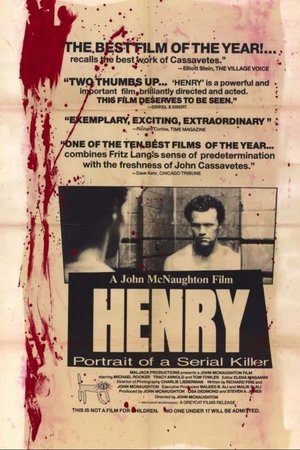„Daddy knows best!“
Im Märchen ist es traditionell die böse Stiefmutter, die sich ungefragt im Leben meist noch kindlicher Protagonistinnen breit macht, den Platz eines geliebten, dahingeschiedenen Elternteils einnimmt und fortan alles daran setzt, das eigene Zuhause in die gefühlte Hölle auf Erden zu verwandeln. Aber wie es Märchen oft so an sich haben, am Ende wird meistens alles wieder gut. Und wenn sie nicht gestorben sind,…Nur handelt es sich bei The Stepfather (hierzulande seiner Zeit auch lange unter dem unmöglichen Titel Kill, Daddy, Kill! vertrieben, der an dieser Stelle gerne ignoriert wird) leider um keine Märchen und so haben die Familien des „professionellen“ Stiefvater-Nomaden Jerry Blake (Terry O'Quinn, Lost) – so nachweislich nicht sein richtiger Name, aber einen glaubhafteren erfahren wir auch nicht – leider nicht das Glück, noch heute zu leben.
Niemand geringeres als Alfred Hitchcock war was Spannungsaufbau betrifft ein Verfechter der Bombe-unter-dem-Tisch-Theorie. So sei es für den Zuschauer wesentlich aufregender mehr zu wissen als die Figuren im Film. Eine ganz konkrete, aber von den handelnden Personen nicht erkannte oder maximal vermutete Bedrohung, bei der es nicht darum ginge, ob und was geschehen wird, sondern nur wann und wie es zur metaphorischen Explosion kommen wird. Nach dieser Devise handelt auch der Film von Joseph Ruben (Der Feind in meinem Bett), in dem er gar keinen Zweifel daran lässt, dass der neue Stiefvater der 16jährigen Stephanie (Jill Schoelen, Skinner) nicht der charmante, witzige, bemühte und großzügige Kerl ist, der er vorgibt zu sein. Stephanie kann ihn schlicht nicht leiden, weil er den Platz ihres verstorbenen Vaters eingenommen hat. Eine durchaus verständliche, wenn natürlich nicht absolut faire Reaktion einer Heranwachsenden. Wir hingegen wissen, dass sie noch weit mehr Gründe haben sollte, Jerry so schnell wie möglich wieder aus ihrem Leben zu verbannen.
The Stepfather beginnt am Schauplatz der jüngsten Bluttat eines besessenen Psychopathen (von Terry O'Quinn bemerkenswert effektiv verkörpert, ohne sich jemals in absurdes Overacting zu verrennen). Besessen von dem Idealbild der amerikanischen Bilderbuchfamilie. Frau, Kind(er), Haus, Hund und Garten, solide Mittelschicht im ruhigen Vorort. Wo Daddy nach einem harten Arbeitstag freudig um den Hals gefallen wird, er immer das letzte Wort hat und alle in steriler Harmonie ihre Rollen ausfüllen. Doch es genügen nur wenige, in der Realität abseits von 50er-Jahre-Cornflakes-Werbespots ganz lebensnahe Haarrisse an dieser herangezüchteten Wahn-Wunschvorstellung, damit beim Hausherren die Hauptsicherung rausspringt und er bereit ist den ultimativen Reset-Schalter zu drücken. Neue Identität, neues Leben, neuer Versuch. Die Altlasten werden entsorgt und genau da setzt die Handlung an. In einem gerade geschehenen, noch nicht geronnenen Blutbad: Dem frischen Massaker an einer Familie, ausgeführt von dem Mann, der nun, ein Jahr später, bereits voll etabliert ist in einer neuen Umgebung, deren Schicksal bereits besiegelt ist. Denn irgendwas wird irgendwann nicht nach seiner verklemmten Biedermeier-Nase gehen und dann kreist buchstäblich der Hammer.
Kein ganz typischer 80er-Horrorfilm mit Prägung der VHS-Ära. Dafür verzichtet The Stepfather auf die Möglichkeit zahlreiche Bodycounts und Splatter-Einlagen aufzutischen, das hält sich für damalige Verhältnisse relativ in Grenzen. Viel mehr versucht sich Joseph Ruben wirklich an einem hinterhältigen Psychothriller, dem die Vorgehensweise des „besserwissenden“ Zuschauers recht gut steht. Was sollte man von einem Genrefilm mit diesem Titel (zu dieser Zeit und unter diesen Voraussetzungen) schon anderes erwarten? Deshalb lieber gleich mit offenen Karten spielen und das Interesse daraus generieren, wann, wie und mit welcher Konsequenz das Unweigerliche geschehen wird. Ein guter Einfall, der aber leider durch keine wirklich pfiffigen Momente großartig unterstützt wird, das läuft alles schön ruckelfrei wie auf Schienen ab, Überraschungen Fehlanzeige. Hat auch seinen Wert, keine Frage, gerade da Terry O'Quinn das Ding fast schon im Alleingang regelt und der sarkastische, amerikanisches Spießbürgertum mit zynischer Ironie parodierender Tonfall durchaus gefällt. Ein böser Witz wohnt The Stepfather durchgehend inne und platzt manchmal treffsicher aus ihm heraus („Who am i here?!“), nur dürfte er seinen lobenswerten Ansätze ruhig noch effektiver, zackiger verwerten. Es scheint bald so, als würde sich der Film selbst zu wenig zutrauen; lieber nur ganz soliden Durchschnitt abliefern, obwohl er weitaus mehr auf dem Kasten hätte.
 Trailer
Trailer