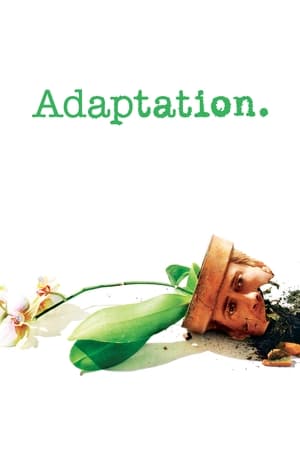Seit jenen Tagen vor ungefähr 50 Jahren, als sie einander erstmals im Alter von 10 Jahren in einem Mädchen-Internat in der Grafschaft Kent im Südosten Englands begegnet waren, so fasst es Tilda Swinton (Memoria, A Bigger Splash) zusammen, würden sie und ihre enge Freundin Joanna Hogg sich über ihre Mütter austauschen. The Eternal Daughter, Hoggs Nachfolgeprojekt zu ihrem gefeierten Souvenir-Diptychon, macht sich nun, abermals von Martin Scorsese produziert, daran, diese Gedanken zu kondensieren und in eine Form zu überführen – ein Versuch, der in seiner technischen Umsetzung weitaus reduzierter daherkommt, emotional jedoch einen ähnlich tiefen Graben fräst, ja womöglich sogar einen noch tieferen, fokussiert sich The Eternal Daughter doch weniger auf die an Hogg angelehnte Julie als auf deren Beziehung zur Mutter Rosalind. Wem der autofiktionale Souvenir-Zweiteiler noch hinreichend frisch im Gedächtnis ist, in dem wir ebenfalls einer Filmemacherin namens Julie folgen – dort allerdings im London der 80er Jahre, porträtiert von Swintons Tochter Honor Swinton Byrne – wird diese Figurenkonstellation wiedererkennen. Einzig, dass es nun Swinton selbst ist, die neben der Rolle von Mutter Rosalind auch jene ihrer Tochter Julie ausfüllt.
Es ist eine bewusste Inkonsistenz, die Hogg uns hier präsentiert, wäre doch davon auszugehen, dass die Schauspielerinnen bei gleichbleibender Figurenkonstellation unverändert demgegenüber bleiben müssten, wie wir sie in Part I und Part II von The Souvenir angetroffen haben. Und doch lässt sich des Eindrucks schwerlich erwehren, dass die fiktionale Welt aus The Eternal Daughter stärker noch den Halt im Außerfiktionalen benötigt als im emanzipatorischen Bildungsroman des Vorgängers, in dem Hogg, in Anlehnung an ihre eigenen Erfahrungen an der Filmhochschule, das Erwachsenwerden ihrer Stellvertreterin Julie mit der Realisierung ihres Abschlussfilms parallelisierte. Denn obgleich es mit der Kontinuität bricht, dass es nun Tilda Swinton zufällt, die Rolle ihrer Tochter zu spielen (also gleichzeitig die Rolle der Tochter ihrer früheren Figur, als auch die Rolle, die Swintons Tochter zuvor gespielt hatte), fände sich wohl keine geeignetere Schauspielerin als Hoggs Kindheitsfreundin, mit der die gebürtige Londonerin 1986 ihren Kurzfilm Caprice drehte – Hoggs Abschlussarbeit an der Universität – der für beide den ersten Eintrag ihrer Filmographie darstellt.
Mit der Doppelbesetzung Swintons entscheidet sich Hogg gegen die inhärente Logik ihrer Fiktion und für die Ambition, der wahrhaftigen Darstellung ihrer eigenen Mutter gerechtzuwerden. „To get it right“, das sei, so Hogg, stets das, wenngleich schier unmögliche, Ziel ihrer Geistergeschichte gewesen, in der Julie und ihre Mutter Rosalind für Recherchezwecke in die winzige Örtlichkeit unweit von Liverpool zurückkehren, in dem Rosalind einst den Großteil ihrer Jugend verbrachte. Mit längst vergessenen Korrespondenzen und zerlesenen Penguin-Taschenbüchern im Gepäck, checken die beiden im nebelverhangenen Hotel am Waldesrand ein, das beinah gänzlich verlassen scheint. Als eine Geistergeschichte angekündigt, löst The Eternal Daughter diesen Ansatz von der ersten Szene des Films an ein. Zu den Streichern aus Béla Bartóks schummriger "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta" fahren wir auf dem Rücksitz eines Taxis durch die diesige Nacht und erfahren vom Fahrer von einer Geistererscheinung, die das Hotel heimsucht. Zu verstehen ist diese opake Geisterfigur, die sich in ihrem Schlohweiß bald schon, fast wie heraufbeschworen, am Fenster von der sie umgebenen Dunkelheit absetzt, jedoch weniger als unheilvolles Ohmen – nur an wenigen Stellen ist Hogg um Spuk im herkömmlichen Sinn bemüht – denn als Vorausdeutung dessen, was insbesondere Julie bevorsteht.
In ständiger Konversation mit ihrer Mutter, am Esstisch des Hotelrestaurants etwa, das, wie der Rest des Hotels, scheinbar einzig von der dauerreservierten Concierge geleitet wird, versucht Julie nun für ihr anstehendes Filmprojekt einen besseren Eindruck davon zu erhalten, wer ihre Mutter einst gewesen ist, und wertet gemeinsam mit dieser weit zurückliegende Schriftstücke und Erinnerungen aus. Präsentiert wird uns dies fast durchgehend durch Schuss-Gegenschuss-Szenen, die sich formal durchaus spröde doch dennoch notwendig gestalten. Findet nämlich ein Dialog zwischen Mutter und Tochter statt, so hören wir als Antwort auf Swintons Stimme, die gerade noch den Lippen der einen entwich, erneut Swintons Stimme, die, in ihrer Intonation nur geringfügig variiert, aus dem Jenseits des Bildausschnitts dringt. Gewiss, es mag sich bei The Eternal Daughter um einen Pandemie-Film handeln, allerdings lassen sich in Hoggs Entscheidung nicht nur der Doppelbesetzung, sondern auch der transparenten Inszenierung, theoretische Ansätze erkennen, die in der anglophonen Literaturwissenschaft mit den Begriffen New Sincerity sowie Metamodernism umschrieben werden. Der Schaffensprozess schreibt sich hier notwendigerweise in das Werk ein.
Fokussierte sich der Postmodernismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts häufig darauf, mithilfe einer — zumeist distanziert-kühlen, ironischen, über den Dingen stehenden — Erzählinstanz den Wesenszustand der Welt als zu schnell, zu verworren, zu komplex zu identifizieren, haben sich viele Schriftsteller*innen und Filmemacher*innen innerhalb der jüngsten Dekaden, wie einst von David Foster Wallace in seinem viel beachteten Essay „E unibus pluram“ antizipiert, von einer solchen Dauerironisierung abgewandt. Statt allerdings einer bloßen Hinwendung zur Welt als rein inhaltliche Aufrichtigkeit, bemühen sich Literat*innen und Regisseur*innen seither darum, den Prozess des Schreibens bzw. des Filmemachens selbst zu thematisieren, insbesondere dann, wenn dieses Unterfangen scheitert. Adaptation etwa, die Kollaboration zwischen Spike Jonze und Charlie Kaufman, die Kaufman und seinen gescheiterten Prozess einer Drehbuchadaption selbst zum Thema des Films avanciert, stellt ein frühes Beispiel dar, und Hoggs Souvenir-Zweiteiler erschien zu einer ähnlichen Zeit wie Ricky D’Ambroses The Cathedral, Nadav Lapids Ahed’s Knee und der kürzlich in Venedig prämierte No Bears des inhaftierten Jafar Panahi, während Sheila Heti, Ben Lerner, (der diesen Prozess von Ironisierung zur Weltzuwendung im Rahmen einer Trilogie erzählt), Chris Kraus (I Love Dick) oder Christian Kracht (Eurotrash) dieser Herangehensweise auf literarischer Weise nahekommen.
Ein Merkmal, das viele dieser Narrative eint, ist die Kennzeichnung bestimmter Figuren als aus der Narration hervorgehend, selbst wenn diese, wie in der Autofiktion nicht selten der Fall, auf realen Personen beruhen. Sich dessen gewahr, gewinnen jene Szenen in The Eternal Daughter an Bedeutung, wenn wir im wenig überzeugenden Make-Up Swintons als pensionierte Rosalind nicht einen technischen Makel des Filmes ausmachen, sondern darin vielmehr Hoggs Markierung erkennen, dass es sich hierbei nicht um ihre Mutter, sondern um eine Projektion ihrer Mutter handelt, was sich nur noch verstärkt dadurch, dass die Figuren bisweilen verschwommen anmuten, ganz so, als hätte sich ein Schleier über das Bild gelegt. Wenn sich also die von Tilda Swinton gespielte Julie selbst in die Augen blickt, wenn sie mit ihrer Mutter spricht, so erkennen wir darin Hoggs Bewusstsein dafür, dass die fiktionalisierte Mutter niemals von ihrem realen Vorbild ausgeht, sondern von jener Person, die sie projiziert; dass man hier zwangsläufig auf das Problem stößt, das Julie anspricht, als sie den Hotel-Manager Bill kennenlernt: das Gefühl, nicht das Recht zu besitzen, in ihrem Film für ihre Mutter zu sprechen. Dass die Hoffnung, „to get it right“, gezwungenermaßen, eine gänzlich ungewisse ist.
Das Drehbuch, das Hogg laut eigener Aussage vollständig verwarf, sobald der Dreh begann, bemüht sich dementsprechend auch zu keinem Zeitpunkt darum, die Wendung, die sich vom Beginn des Films an ankündigt, auf eine kunstfertige Weise zu verhüllen. Statt die Seherfahrung des Publikums durch die unvermeidliche Wendung an die Narration zu binden, ist es stattdessen Julies allmähliche Realisierung ihrer Welt, die das Zentrum dieser Tochter-Mutter-Geschichte bildet und uns Zuschauer*innen somit noch stärker mit unserer Beobachter*innenposition konfrontiert.