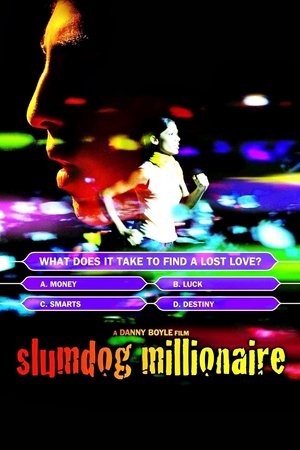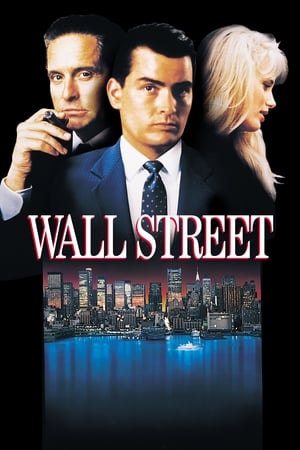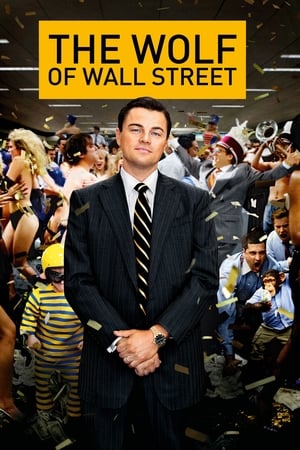Ashok (Rajkummar Rao – D-Day), Pinky (Priyanka Chopra – Baywatch) und ihr Fahrer Balram (Adarsh Gourav – My name is Khan) rauschen mit dem Auto durch das nächtliche Delhi. Im Radio ertönt ein bekannter Popsong. Ashok und Pinky kommen von einer Party, sind betrunken, ausgelassen und unvorsichtig. Balram lässt sich davon mitreißen – sogar dann, als Pinky darauf besteht zu fahren. Balram hat keine Einwände: Pinky, weiß, was sie tut. Immerhin ist sie reich, lebt in den USA und hat ihr Leben im Griff. Die Tragödie ist nicht weit entfernt. Aber so möchte Protagonist Balram seine Geschichte nicht starten. Er blickt in die Vergangenheit: Zurück in sein kleines Dorf, das von einem reichen Mann beherrscht und monatlich ausgeraubt wird, während die Dorfbewohner in körperlicher Arbeit und tiefer Armut verenden. Balram will ausbrechen aus dieser Welt. Und er weiß genau, wie: Auch er muss ein Gangster werden.
Schon früh macht Regisseur Ramin Bahrani (Fahrenheit 451) deutlich, worum es ihm in den folgenden 125 Minuten geht. Basierend auf dem preisgekrönten Bestseller porträtiert Der weiße Tiger eine indische Gesellschaft, die dem Kapitalismus längst in seiner schlimmsten Form erlegen ist. Eine Mittelschicht gibt es nicht. Stattdessen teilt sich das Land in enorme Armut und eine dünne reiche Oberschicht, die ohne Konsequenz macht, was sie will und ihr Geld durch Korruption und Betrug erlangt. Balram heuert bei eben jenem Mann an, der sein Dorf seit Jahren ausnimmt. Er bekommt eine Stelle als Fahrer für den jüngeren Sohn Ashok. Dieser beginnt den Film als scheinheiliger Weltverbesserer, dessen vorgeschobener, „hipper“ Moralkodex – ebenso wie bei seiner Freundin Pinky – schon bei der geringsten Erschütterung zerbricht. Bei Geld hört der Spaß eben auf.
Der weiße Tiger zeichnet ein unheimlich kritisches Welt- und Menschenbild. Selbst die ach so emphatische Jugend verfällt im Angesicht des eigenen Nachteils schnell dem korrupten System. Fressen oder gefressen werden ist die ständige Devise. Ein Ansatz, der sich dem hochglanzpolierten indischen Bollywood- oder Actionkino, das stets die Eskapaden der Reichen, Schönen und Starken in den Mittelpunkt stellt, aktiv entgegenstellt. Das mag nicht sonderlich subtil sein, funktioniert in Bahranis Drama aber trotzdem ausgezeichnet.
Denn Der weiße Tiger verweigert sich auch nach 125 Minuten der großen Moralkeule. Stattdessen wird Balrams finanzieller Aufstieg und damit einhergehender moralischer Abstieg als einzige Möglichkeit inszeniert, irgendwie aus der eigenen Armut zu entfliehen. Statt dem Gangster im typischen „Rise-and-Fall“-Prinzip am Ende mit ausgleichender Gerechtigkeit zu begegnen, existiert diese in Bahranis Indien schon gar nicht mehr. Nicht korrpute Einzeltäter sind Ziel von Bahranis Kritik, sondern das gesamtheitliche System, das den Figuren gar keine andere Wahl lässt als ihre Moral im wahrsten Sinne des Wortes zu verkaufen.
Getragen wird diese Odyssee von einer unheimlich energetischen Inszenierung. Wer sich erhofft mit Der weiße Tiger auch inszenatorisch in die indische Kultur abzutauchen, wird enttäuscht. Der Film ist amerikanisch produziert und fühlt sich auch durch und durch so an: Schnelle Schnitte, ironisches Voice-Over, bunte Farben, ein hipper Soundtrack – Der weiße Tiger mag in dieser Hinsicht angreifbar sein, er verwebt all diese Mittel aber zu einem mitreißenden Ganzen. Außerdem stellt der Film seine oberflächliche, fast humoristisch anmutende Inszenierung wirksam in Kontrast zur tieferliegenden Botschaft. Das Ergebnis ist wunderbar zynisch, ohne je die Botschaft aus den Augen zu verlieren. Bei Der weiße Tiger bleibt einem im wahrsten Sinne des Wortes das Lachen im Halse stecken.
Zu guter Letzt trägt auch Hauptdarsteller Adarsh Gourav dazu bei, dass man Balram bei seiner Reise ins kapitalistische Herz der Finsternis folgt. In seiner ersten größeren Filmrolle leistet der Hauptdarsteller unheimliches: Allein mimisch nimmt man ihm stets die Zerrissenheit seiner – anders kann man es nicht sagen – Sklavenrolle ab. Die Abhängigkeit zu seinen „Meistern“ und der damit einhergehende Hass sind zentrale Bestandteile der Figur, die Gourav bravurös auf den Zuschauer überträgt. Ohne diese Leistung hätte Der weiße Tiger schnell in die Selbstparodie abgleiten können. Das passiert nicht. Ganz im Gegenteil: zum Trotz seiner poppigen Inszenierung evoziert Der weiße Tiger zum Schluss das essentielle ungute Magengefühl. Absolut empfehlenswert!
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org