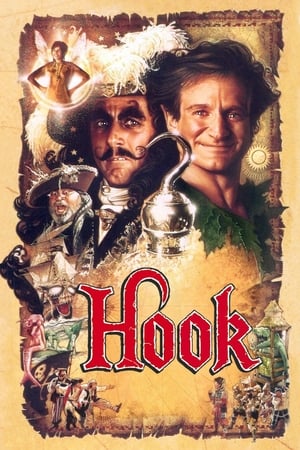Kritik
Jedes Kind ist schon einmal in Berührung mit dem Namen Peter Pan gekommen, was folgerichtig bedeutet, dass auch jedem Erwachsenen die Geschichte aus der Feder des viktorianischen Dramatikers James Barrie geläufig ist. Die Besonderheit an der in literarischer Form millionenfach verkauften, mehrfach verfilmten und für die Bühne aufbereiteten Erzählung ist, dass beide Parteien dieser nach wie vor etwas abgewinnen können, reflektiert Peter Pan doch explizite Ängste der jeweiligen Altersgruppe. Die Furcht vor dem Verlust ist hier der entscheidende Aspekt, um dem Märchen ein überzeitliches Gewand zu verleihen: Der Verlust der Persönlichkeit, der Identität, des Seins - oder der Verlust einer geliebten Person. Peter Pan schon immer den Anschein einer (selbst-) therapeutischen Versuchungsanordnung erweckte, hat auch den deutsch-schweizerischen Filmemacher Marc Forster (World War Z) fasziniert.
Marc Forster, der mit dem Oscar-prämierten Ensemblefilm Monster's Ball seinen großen Durchbruch in Übersee feiern durfte, nimmt sich mit Wenn Träume fliegen lernen der Entstehungsgeschichte hinter Peter Pan an und adaptiert damit Allan Knees gefeiertes Bühnenstück Der Mann, der Peter Pan war. Im Zentrum der Handlung steht der Autor James Barrie (Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden), dessen berufliche Karriere nicht nur stagniert – sein letztes Stück war ein echter Flop, der das Publikum zum gelangweilten Schnauben animierte -, auch privat läuft es für James nicht rund: Seine Ehe mit Mary (Radha Mitchell, The Frozen Ground) ist erkaltet, was seine Inspiration für Neues weitestgehend brach gelegt hat. In diesen Sequenzen, in denen Wenn Träume fliegen lernen den Schwund der Schöpferkraft seines Hauptakteurs herausstellt, wird die Verlustangst der selbigen deutlich gemacht.
James befindet sich im Klammergriff der Angst, das Kind in sich verloren zu haben. Oder nicht schlimmer: Es aufgrund von gesellschaftlichen Restriktionen nie wieder aus seiner Seele herauslassen zu dürfen. In einer Szene sagt er deswegen auch zu dem kleinen Peter (Freddie Highmore, Der goldene Kompass) – der entscheidende Impuls, um die Figur Peter Pan zu entwickeln -, dass er den gigantischen Wal in seiner Phantasie niemals gefangen halten darf. Mit dem Zusammentreffen von James und Peter (sowie der Familie von Peter), entwickelt sich Wenn Träume fliegen lernen mehr und mehr zu Ode an das Fabulieren, an die Grenzenlosigkeit der eigenen Vorstellung. Regisseur Marc Forster, der zweifelsohne ein begabter Handwerker ist, weiß der Phantasie, die James propagiert, allerdings nicht in adäquate Bildwelten umzusetzen. Seine Inszenierung ist wenig sinnlich, fast schon bieder.
Gleiches gilt auch für den halbgaren Umgang mit den Mühlsteinen der sozialen Realität, die Wenn Träume fliegen lernen zwar ankratzt, aber kaum kontextualisiert oder vertieft. Dass sich diese Geschichte um den Aufbruch in fremde Dimensionen (nämlich jenen, die unseren Köpfen innewohnen) aber dennoch entfalten kann, liegt an dem wunderbaren Ensemble. Während Freddie Highmore, Kate Winslet (Little Children) oder Dustin Hoffman (Kramer gegen Kramer) in wichtigen Nebenrollen hochkarätig fungieren, liefert Johnny Depp als Dreh- und Angelpunkt eine sensationelle Leistung ab. Seine Performance ist subtil wie wahrscheinlich noch nie zu vor und ringt seiner pointierten James-Barrie-Interpretation einige wahrlich überraschende Ambivalenzen ab. Und durch diese Zurückgenommenheit gewinnt Wenn Träume fliegen lernen an Gestalt, weil er das Vermögen der Phantasie nicht nur über das Erschaffen herleitet, sondern simultan dazu auch über das natürliche Verenden sinniert.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org