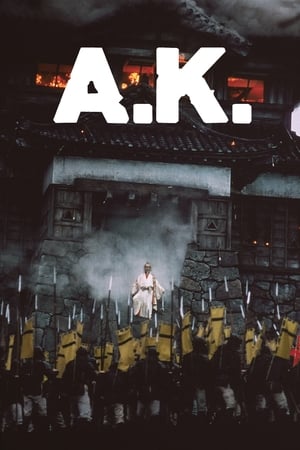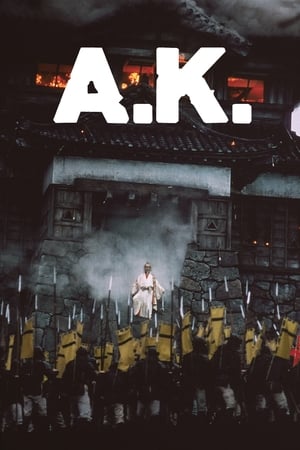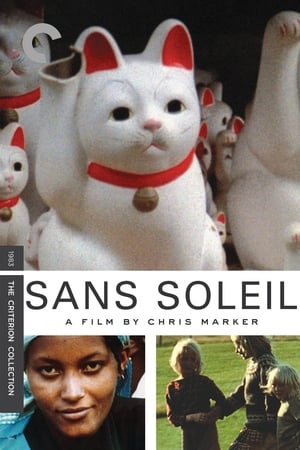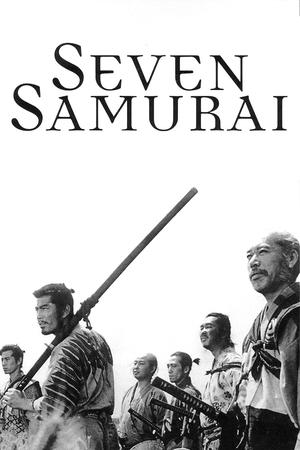Kritik
Es sind viele legendäre Elemente in dieser Dokumentation vereint. Der japanische sensei Akira Kurosawa (Die sieben Samurai), der in seiner langen Karriere eine noch längere Liste an Meisterwerken erschuf, wurde während des Drehs seines letzten Epos von dem französischen Filmemacher Chris Marker (Sans Soleil - Unsichtbare Sonne) begleitet. Dieser ist in seiner Zunft nicht minder anerkannt als Kurosawa selbst, blieb einer breiten Masse jedoch eher verborgen. Als Kurosawa in der Mitte der achtziger Jahre Probleme hatte, seinen groß angelegten Kostümfilm Ran zu produzieren, wurde das Vorhaben von französischen Investoren gerettet. Ob durch diese internationale Verbindung das Zusammentreffen der beiden Filmemacher entstanden ist, bleibt Spekulation.
Man muss Erinnerungen haben, um die Zukunft entfalten zu können. Mit dieser ersten Kernaussage der Dokumentation legt Chris Marker fest, was er im Laufe seines Werkes noch weiter verfolgen wird: Der Schlüssel zu Akira Kurosawas Werk liegt in seinem Leben selbst. Seien es Erinnerungen an die chaotische Zeit nach dem großen Edō-Erdbeben, für das die Koreaner schuldig gemacht wurden, oder Erinnerungen an die geborgene Kindheit auf dem Schaukelpferd. Marker sucht dabei die Beispiele und Gründe des Schaffens nicht im direkten Gespräch, sondern über sekundäre Quellen: Kurosawas Autobiographie, ältere Ton-Aufzeichnungen, Gespräche mit Dritten. In A.K. wird dem japanischen Filmemacher über die Schulter geguckt, während der Dreh von Ran in vollem Gange ist. Der Fokus der Dokumentation liegt dabei weniger auf dem Film an sich und mehr auf Kurosawa; wie er arbeitet, mit wem er arbeitet, warum er arbeitet.
Dabei benutzt Marker - ob zufällig oder beabsichtigt bleibt offen - die gleichen Bildelemente und visuellen Muster wie Kurosawa in seinem Film. Das ist charmant und wird treffend durch einen inszenierten Ort ergänzt. Ein anonymer Ort, mit vorherrschenden roten Wänden, einem Fernseher, auf dem Kurosawas Filme laufen und einem von einer Hand gehaltenen Tongerät. Ist es Marker, der sich selbst inszeniert? Wenn ja, dann tut er es auf eine Art und Weise, die dem Zuschauer suggeriert, von ihm unter seine Fittiche genommen zu werden. Gleichzeitig wird der Zuschauer etwas von dem Gesehenen distanziert. Er ist dabei; keine Frage. Aber er sitzt nicht in der ersten Reihe. Nur gucken, nicht anfassen. Es ist gut möglich, dass Chris Marker einer ähnlichen Politik am Set zuteil wurde. Seine Kameras beobachten nämlich heimlich, still und leise. A.K. ist ein intimer und stumm verehrender Film, der lieber nichts sagt, um bloß niemanden zu stören.
Und das ist irgendwie schade. Denn so sammelt Marker für jeden Pluspunkt des Werkes auch Minuspunkte. Einerseits punktet der französische Filmemacher durch messerscharfe Beobachtungen, die von dem speziellen Humor der Nouvelle Vague durchzogen sind. Da wäre die Charakterisierung von Kurosawas engstem Gefolge als die sieben Samurai. Da wäre der Regie-Assistent Vittorio, „der von Natur aus mit 16 Bildern pro Sekunde lief“. Dazu sieht man Bilder eines rennenden Vittorios. Diese Verbindung von Filmtechnik, Humor und alltäglichem Leben, wie sie typisch für den französischen Film war, sie findet auch hier zu charmanten Höhen. Diese werden jedoch zunichte gemacht. Beispielsweise durch die Tatsache, dass das Filmprojekt ein wenig so wirkt, als hätte es eine Laufzeit von drei Stunden haben sollen, wäre nicht jemand gekommen und hätte wahllos Szenen herausgenommen. So liefert Marker eine lose zusammenhängende Kette an Eindrücken. Interessant, natürlich, aber nicht der erhoffte große Wurf.