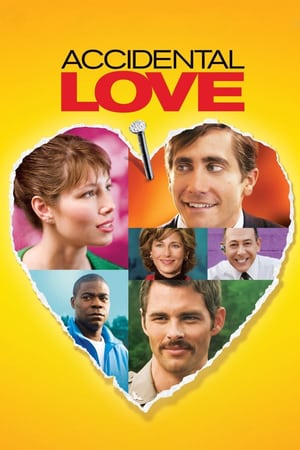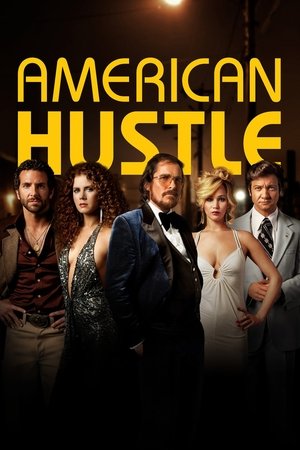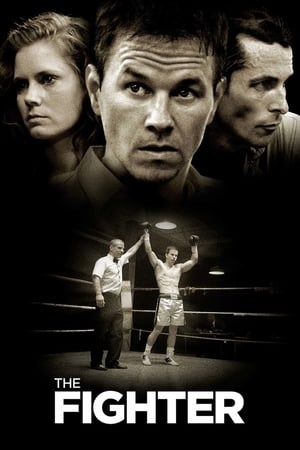Im Jahre 1933 schmiedeten einflussreiche Geschäftsleute in der Vereinigten Staaten von Amerika ein Komplott, um die Regierung zu stürzen und Präsident Franklin D. Roosevelt durch einen Diktator zu ersetzen. Dieser politischen Verschwörung, die als Business Plot in die Geschichtsbücher einging, bedient sich nun der fünffach oscarnominierte Regisseur David O. Russel (The Fighter), indem er sie in einen Flickenteppich der Fiktion einwebt. Denn in seinem zehnten Spielfilm Amsterdam erzählt er die Geschichte eines Trios bestehend aus dem Doktor Bert Berendsen (Christian Bale, Feinde - Hostiles), dem Anwalt Harald Woodman (John David Washington, Tenet) und der Künstlerin Valerie Voze (Margot Robbie, Barbie), die durch ominöse Umstände in die finsteren Machenschaften der im Verborgenen agierenden Wohlstandsbürger hineingezogen werden. Ehe sie sich versehen, sind die beiden Herren der Dreiecksbeziehung Part dieser Konspiration und die Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Um ihre Unschuld zu beweisen, gilt es demnach die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Was wie die Prämisse für einen vielversprechenden Politthriller klingt, entpuppt sich jedoch nach und nach als das Rollfeld, auf dem das Publikum in den nächsten 132 Minuten Zeuge von einer obskuren Bruchlandung wird. Denn Amsterdam rangiert irgendwo zwischen atmosphärischem Thriller und mit Kuriositäten gespickter Farce, sodass sich bereits in den ersten Minuten ein überaus fragwürdiger Ton über die Erzählung legt. Ernst und Komik geben sich hier nicht die Hand, sondern rangieren sich gegenseitig aus, was dazu führt, dass das verschwörerische Mysterium, das wie ein Damoklesschwert über den Protagonist*innen schwebt, nie eine tatsächliche Bedrohung darstellt und somit auch keine Spannung kreiert. Wie soll das Publikum demnach die Geschehnisse auf der Leinwand ernstnehmen und mitfiebern, wenn das Gefühl erwächst, dass nicht einmal die des Mordes beschuldigten Hauptakteure der Situation keinen Glauben schenken?
Stattdessen stolpert der ulkige Kautz Burt Berendsen, der wie eine aus einem Saturday Night Live-Sketch entsprungene Karikatur wirkt, durch eine Aneinanderreihung an Szenen, dessen Bilder oftmals von plumpen Ideen und einer aufdringlichen Protzerei durchzogen sind. Denn nahezu jedes Mal, wenn einer der hochkarätigen Hollywood-Stars vor die Linse schreitet, fährt die Kamera auf diese Person zu und rahmt sie in einer Einstellung, als wäre gerade Gott höchstpersönlich ins Bild getreten. Die Geschichte wirkt hier wie die beigelegte Broschüre zum großen Hollywood-Showlaufen, das sich bei der unvollkommenen Erzählweise jedoch eher wie ein Showtappen erweist. Mit jeder Annäherung an die Auflösung tätigt Amsterdam einen Schritt auf dem Pfad der Langeweile und verlangt seinem Publikum nur noch mehr Geduld ab.
Im Hinblick auf die Beherbergung von derart vielen hochkarätigen Hollywood-Stars gelingt David O. Russel jedoch auch ein kleines Kunststück. Denn bei Amsterdam hat man nicht das Gefühl, dass die Darsteller*innen um das Rampenlicht ringen und sich gegenseitig die Show stehlen, sondern teilt der Film die Talent-Riege auf verschiedene Fragmente ein. Die drei Protagonist*innen duchqueren auf ihrer Suche nach der Wahrheit verschiedene Stationen und bei jedem dieser Stopps treffen sie auf neue Figuren, die – im Gegensatz zu anderen mit massig Hollywood-Stars überladenen Produktionen – stets eine Daseinsberechtigung unter Beweis stellen. Wo beispielsweise das Talent von Christoph Waltz (Inglourious Basterds) in „The French Dispatch“ als verschenkt erscheint, kommen die Darsteller*innen dank dieser nahezu episodenhaften Struktur trotz teils recht kurzer Screentime gut zur Geltung. Ein smarter Schachzug in einem Spiel voller Fehlzüge.
Am Ende nimmt Amsterdam schließlich eine plötzlichen Kehrtwende und liefert den Zuschauer*innen im Kinosessel sowie den anwesenden Figuren im Bankettsaal eine Rede, die ans Herz zu gehen vermag. Mit seinen Worten richtet sich General Gil Dillenbeck (Robert De Niro, Wag the Dog) an seine Mitmenschen und hält ihnen ein Plädoyer über Standhaftigkeit, den Kampf gegen Unterdrückung und die Aufrechterhaltung der menschlichen Moral. Der fade Beigeschmack dabei ist jedoch, dass dieses Ende viel zu prompt kommt. Irgendwo in diesem Knäuel von Erzählsträngen steckt eine spannende Geschichte, die ideal in dieses Ende hätte überlaufen können. Doch leider wurden die einzelnen Stränge beim Entwirren derart zerstückelt, dass sich das große Finale wie aus dem Nichts gegriffen anfühlt. Wäre Amsterdam ein paar Minuten länger und hätte David O. Russel auf die überflüssigen Voice-Over Erklärungen seines Protagonisten verzichtet, wäre der Weg zu dieser Rede womöglich nicht ganz so holprig gewesen. Drum wirkt das wirre Dramedy-Spektakel am Ende des Tages so, als hätte der 64-jährige Regisseur den ersten Entwurf seines Drehbuchs verfilmt. Über diesen Umstand kann dann auch nicht halb Hollywood hinwegtäuschen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org