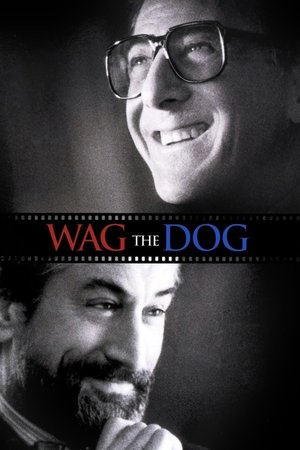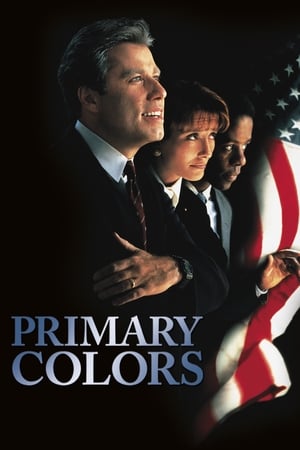Warren Beatty ist ein Phänomen der Effizienz. Obwohl seit 1957, also seit seinem 20. Lebensjahr, als Schauspieler tätig, hat er in gerade mal 23 Kinofilmen mitgespielt. Wer aus dem Stehgreif nur die Hälfte aufzählen kann, darf mit Fug und Recht als Vollblut-Cineast bezeichnet werden. Und trotzdem ist der Mann eine lebende Hollywood-Legende. Ein von Annette Benning (Bugsy) Anfang der 90er an die Ehe-Kette gelegter Ex-Playboy der Traumfabrik, der spätestens ab Mitte der 70er sehr bewusst selektierte, worauf er Lust hatte. Ab und an inszenierte er das auch selbst. Wie 1998 bei Bulworth, seiner vierten von bis heute sechs Regiearbeiten, zu der er auch das (Oscar-nominierte) Drehbuch beisteuerte. Der kommerziell große Erfolg blieb ihm verwehrt, genau genommen verschwand der Film nahezu im Ferner-liefen-Bereich, trotz des allgemein guten Kritiker-Feedbacks. Ein Phänomen - ein echter Beatty.
„We need a spirit, Bulworth…not a ghost!“
Durch waghalsige Aktienspekulationen nahe des finanziellen Ruins, beruflich völlig ausgebrannt am Rande des Nervenzusammenbruchs: Der kalifornische, demokratische Senator Jay Billington Bulworth (Beatty) steht kurz vor der erfolgreichen Wiederwahl und ist dennoch persönlich am Ende. Hat die Schnauze voll von der verlogenen Scheinwelt der Politik, kann seine eigenen, abgedroschenen Phrasen nicht mehr hören, die Zwecks-Anwesenheit seiner untreuen Gattin (Christine Baranski, Mamma Mia!) nicht mehr ertragen – das Maß ist voll. Schnell schließt er bei einem seiner schmierigen Wahlkampfsponsoren eine horrende Lebensversicherung ab, um im Anschluss über Mittelsmänner auf sich selbst einen Killer anzusetzen. Wenigstens soll seine Tochter von seiner Lebensmüdigkeit noch profitieren. Seines baldigen Ablebens bewusst ist es dem Politiker zum ersten Mal seit Ewigkeiten total wurscht, was andere von ihm denken und so lässt er bei einem Auftritt vor einer schwarzen Kirchengemeinde in Compton komplett die Sau raus. Lässt alle Floskeln und solidarischen Heucheleien stecken und posaunt das raus, was alle wissen, aber niemand in seiner Position jemals öffentlich aussprechen würde. Das schockt sein Gefolge, das Irritiert das Publikum, aber Bulworth selbst fühlt sich so befreit wie seit einer Ewigkeit nicht mehr.
Berauscht von der eigenen Courage, der Entledigung beruflicher Zwänge, der vernichtenden Wahrheit, Dope, Schmetterlingen im Bauch aufgrund der Präsenz der taffen Nina (Halle Berry, Cloud Atlas) und nicht zuletzt durch die neu entdeckte Passion zum Rap verwandelt sich der einst korrupte, gierige und gewissenlose Politiker in ein Rhymes droppendes Sprachrohr der schwarzen Unterschicht. Was Geldgeber (Paul Sorvino, Nixon – Der Untergang eines Präsidenten) und insbesondere seinen panisch-verkoksten Spin-Doctor (Oliver Platt, Lake Placid) in den Wahnsinn treibt, allerdings bei der breiten Bevölkerung erstaunlich gut ankommt. Ehrlich währt am längsten, selbst wenn der Rahmen gelinde gesagt im ersten Moment merkwürdig erscheinen mag. So absurd wie vielleicht auch die Prämisse von Bulworth, die sich allerdings in seinem Dasein als griffig-ironische Persiflage auf politische Gebaren (nicht US-exklusiv, aber im Detail schon sehr spezifisch) gekonnt und in pointierten Momenten gar grandios verkauft.
Großen Anteil hat daran natürlich der allgegenwärtige Warren Beatty, der sich im Gegensatz zu früheren Regiearbeiten nicht unpassend-eitel selbst inszeniert, sondern reflektierend versteht auch das eigene Image ein Stückweit auf’s Korn zu nehmen. Bar jedem Narzissmus entdeckt er echtes, humoristisches Talent. Liefert treffsichere Situationskomik ab und rockt natürlich das Haus mit sensationell-plumpen Punchlines, die wirklich so klingen, als würde ein konservativer, weißer Politiker zum ersten Mal in seinem Leben mit Rap hantieren. Und dabei seine eigene „Hood“ so famos dissen, weil sie ihm nun einfach scheißegal ist. Dank der sarkastischen Intention und einiger wunderbaren Momentaufnahmen kann Warren Beatty auch über dramaturgische Engpässe hinwegtäuschen. Warum ausgerechnet das Drehbuch für den Oscar nominiert wurde verwundert etwas, vermutlich wurden da eben jene Vorzüge hervorgehoben, wobei das Narrative keine große Kunst darstellt. Bulworth ist eine etwas oberflächliche, dennoch sehr amüsante Satire, die hervorragend gespielt ist und über eine erfrischend-abenteuerliche Idee verfügt. Das blendet sicherlich, aber überzeugt mit viel Charme und teils skurriler Komik auf gehobenem Niveau. Sollte übrigens zwingend im Original gesehen werden, trotz einer erstaunlich guten Synchro, was unter den Voraussetzungen fast unmöglich scheint. Da wird viel Wortwitz und Timing sinngemäß und vom Effekt trotz notwendiger Abwandlungen übertragen, sehr bemerkenswert.
„Fucking everybody, ´till we’re all the same color.“
 Trailer
Trailer