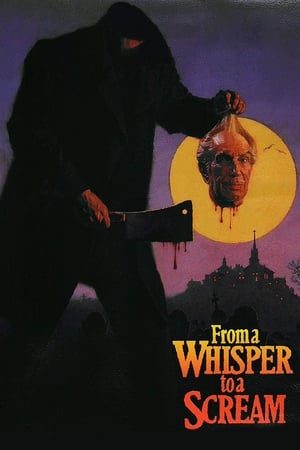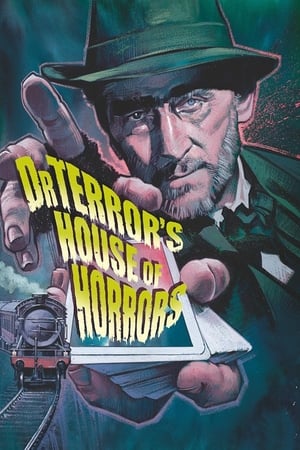Die Nacht der Schreie oder From a Whisper to a Scream, wie der Film im Original heißt, war das Spielfilmdebüt des bei Drehbeginn gerade einmal 22jährigen Regisseurs Jeff Burr (Leatherface), der vor wenigen Tagen erst im Alter von nur 60 Jahren verstorben ist. Knapp zwei Jahre dauerte es von Drehbeginn bis zu seinem Release im Jahr 1987 und besonders erfolgreich war dieser Low-Budget-Anthology-Horror nicht. Vielleicht kam er dafür ein Stück zu spät, denn das Interesse an Filmen dieser Art hatte nach dem letzten, größeren Erfolg Die unheimliche verrückte Geisterstunde (Creepshow) stark abgenommen und auch dessen eigener Nachfolger – der im selben Jahr erschien – konnte schon längst nicht mehr daran anknüpfen. Dieser Film ging nahezu komplett unter und genießt auch heute nicht allzu große Bekanntheit, obwohl er in vielerlei Hinsicht durchaus beachtlich ist.
Da wären z.B. die vielen bekannten Gesichter, die es dort zu entdecken gibt. Als großer Star dient natürlich Vincent Price (Der Hexenjäger), der speziell in den 60er Jahren in zahlreichen Anthology-Gruselfilmen zu sehen war. Als Bibliothekar Julien White führt er in der Rahmenhandlung durch den Film, der hauptsächlich aus vier seiner Erzählungen besteht, die über die dunkle und oftmals auch fantastische Vergangenheit der Kleinstadt Oldfield berichten. Price muss dabei naturgemäß gar nicht so viel machen, seine Filmauftritte waren damals alters- und gesundheitsbedingt eh nur noch rar gesät, kann aber allein durch seine Präsenz und nimmer müde Spielfreude schon klare Akzentpunkte setzen. Die anderen, bekannteren Namen verteilen sich dabei auf die einzelnen Episoden, müssen auch nicht jedem etwas sagen. Aber wer sich etwas mehr mit Filmen dieser Tage auseinandergesetzt hat, dürfte den ein oder anderen wiedererkennen.
„Grace, ich hätte dir Blumen mitbringen sollen.“
Die erste Geschichte „Stanley“ erzählt vom gleichnamigen Protagonisten (Clu Gulager, Die letzte Vorstellung). Einem schüchternen, eigenbrötlerischen Dauerjunggesellen schon bald nicht mehr mittleren Alters, der zusammen mit und voll unter der Fuchtel seiner hypochondrischen Schwester lebt. Da bleibt wenig Zeit für das eigene Liebesleben – wenn es denn eines geben würde. Irgendwann nimmt Stanley allen Mut zusammen und bittet seine angebetete Arbeitskollegin Grace um ein Date. Vollkommen überraschend nimmt diese an, der Abend verläuft aber eher suboptimal. Und als wenn das nicht alles schon schrecklich genug wäre, ist es gar kein Vergleich zu dem, was ein Dreivierteljahr später ziemlich unerwartet danieder kommt. Dies mag zwar die trashigste Episode des Films sein, aber sie gibt schon sehr treffend die Marschrichtung vor. Es wird böse, äußerst makaber und scheut sich nicht vor extremen Momenten. Dazu wirklich gut, da immer selbstironisch, aber nie lächerlich gespielt wie inszeniert. Als Auftaktepisode perfekt, da sicher noch mit Steigerungspotenzial, aber schon mit einem markanten Ausrufezeichen versehen, auf was man sich hier einstellen kann.
Bei „On the Run“ steht der halbseidene Gauner Jesse (fabelhaft wie immer: Terry Kiser, Immer Ärger mit Bernie) im Mittelpunkt. Dieser wird von „Geschäftskollegen“ angeschossen und schleppt sich mehr tot als lebendig auf ein Boot, dass durch die Sümpfe treibt. Dort wird er von dem Einsiedler Felder (Harry Caesar, Ein Vogel auf dem Drahtseil) gerettet und aufgepäppelt. Felder versteht sich als Meister von Voodoo und schwarzer Magie und hat sich damit ein unnatürlich langes Leben gesichert. Als Jesse dahinterkommt, möchte er zwingend hinter dieses Geheimnis kommen. Dankbarkeit, Geduld und Vernunft zählten noch nie zu seinen ausgeprägten Charaktermerkmalen, weswegen er es seinem Retter mit Gewalt entlocken will. Ein schwerer Fehler, denn nicht sterben zu können kann einige äußerst unangenehme Nebeneffekte haben. Die vermutlich beste Episode, da in der Kürze der Zeit eine bitterböse, aber dennoch „gerechte“ Geschichte erzählt wird, die alles mitbringt, was so ein Anthology-Konzept im Idealfall haben sollte. Und Terry Kiser ist grandios. Völlig unverständlich, dass dieser Mann nicht eine wesentlich größere Karriere hingelegt hat.
„Lovecraft’s Traveling Amusements“ erzählt von einer Freakshow in den 1930er Jahren, deren „Ausstellungsstücke“ nicht unbedingt freiwillig hier sind und von der Direktorin mittels Voodoo-Zauber an die Show „gebunden“ werden. Glasesser Arden verliebt sich jedoch unsterblich und versucht, mit seiner Angebeteten zu fliehen. Das gestaltet sich allerdings alles andere als einfach und führt zu einigen drastischen Bestrafungen. Eindeutig die schwächste der vier Episoden, da hier relativ wenig erzählt wird und nur die Schauwerte etwas länger im Gedächtnis bleiben dürften. Die sind dafür ordentlich. Der Begriff Body-Horror schwebt unausgesprochen eh über allen Geschichten, hier darf man das aber absolut wörtlich nehmen. Allgemein gilt es zu sagen (da man über diese Story nicht so viel kann): für eine Low-Budget-Produktion sind die teilweise sehr drastischen Effekte klasse. Kaum zu glauben, dass es sich hierbei um ein quasi vom Munde abgespartes Spielfilmdebüt eines 22jähringen handelt. Hut ab, da muss auch nicht alles sitzen.
„Four Soldiers“ spielt in den letzten Tagen des Bürgerkriegs. Ein verstreutes Quartett von Yankees, angeführt durch Sgt. Gallen (Cameron Mitchell, Blutige Seide), kommt in das Südstaaten-Kaff Oldfield. Sie haben zwar gerade per Zufall erfahren, dass der Krieg offiziell vorbei ist, aber ein Bisschen Plündern und Vergewaltigen würden sie dann doch noch gerne mitnehmen, bevor es nach Hause geht. Merkt ja keiner. Allerdings gibt es in Oldfield nichts mehr zu plündern und nur zu vergewaltigen, wenn man extrem kranke Neigungen hat. Denn sie werden überrumpelt und gefangen genommen von den Kindern des Orts, die die einzigen Überlebenden sind. Und sich mit dieser rauen Welt entsprechend arrangiert haben. Gallen glaubt, sich mit Geschick aus dieser brenzligen Lage retten zu können, unterschätzt dabei aber die Kompromisslosigkeit, zu dem diese verstörten Kriegswaisen inzwischen bereit sind. Schon ziemlich heftiger Stoff, der einem hier aufgetischt wird. Aber genau so was musst du an diesem Punkt liefern und es verdeutlicht nur, wie unglaublich gut Die Nacht der Schreie das eigene Pacing im Griff hat. Zum Finale bitte nochmal richtig drastisch.
Abgerundet wird das Ganze dann durch die Pointe der Rahmenhandlung und was letztendlich hier den ganz entscheidenden Punkt ausmacht: trotz vier Geschichten, Pro- und Epilog (der quasi eine fünfte Episode darstellt und zudem einen sinnvollen, allummantelnden Zweck erfüllt), ist man bei 100 Minuten. Das Zeitmanagement ist für so einen Film nahezu ideal. Die einzelnen Geschichten sind immer kurz, knackig und schaffen es trotzdem, ihr Anliegen zielgerichtet zu vermitteln. Da ist in der Tat kein Gramm Fett zu viel dran, im Gegenteil. Mehr Laufzeit würde praktisch jeder Episode nur schaden. Das funktioniert exzellent und die Inszenierung ist für die vorgegebenen Mittel erstaunlich souverän. Die üblichen Probleme eines Anthology-Films sind dafür genauso präsent. Es gibt fast unvermeidliche Ups und Downs und am Ende ist es halt „nur“ eine Ansammlung von kleinen Häppchen, die nicht diese Wirkung einer durchgehend packenden Geschichte (auf entsprechend hohem Niveau) entfalten können.
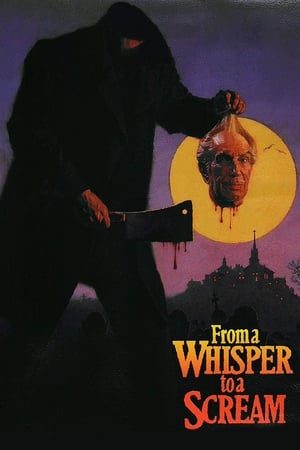 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org