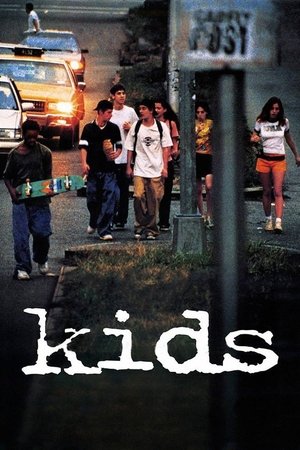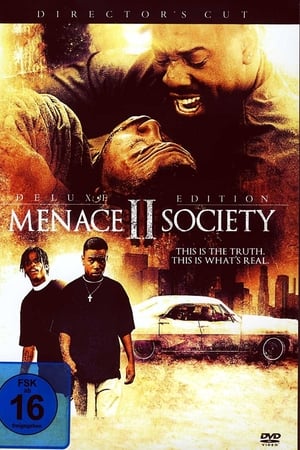„Alles Verlorene kann man wiederholen, außer verschwendete Zeit.“
Baustein für Baustein. Straßenpflaster für Straßenpflaster. Haus um Haus, Kreuzung um Kreuzung, Schild um Schild, Graffiti um Graffiti. In der Eröffnung von Fresh erklärt Regisseur und Drehbuchautor Boaz Yakin (Safe – Todsicher) den New Yorker Stadtteil Brooklyn zur sich aufblätternden Modelllandschaft. Mit jedem neuen Gebäudekomplex und jedem Richtzeichen, mit jedem Mülleimer, jeder Seitengasse und jeder Laterne, komplettiert sich die großstädtische Architektur und ergibt, rein strukturell, etwas Ganzes, etwas Einheitliches. Dass diese Exposition etwas Programmatisches für den weiteren Verlauf der Handlung mit sich trägt, versteht sich von selbst, denn das methodische Errichten einer Metropole, respektive einem Fragment jener, verweist auch auf den Inhalt des Films sowie auf die Bewohner Brooklyns, die Zeit ihres Lebens einem methodischen Prinzip unterworfen werden – ob sie wollen oder nicht.
Opfer dieses Prinzips ist auch der 12-jährige Fresh (Sean Nelson, Die Entführung der Pelham 1 2 3), der am eigenen Leibe erfahren musste, wie es ist, in kriminelle Energien hineingeboren zu werden und nie die Chance erhalten zu haben, unbeschwert Kind sein zu dürfen. Fresh nämlich dealt mit Drogen, Gewalt gehört zu seinem Alltag, von familiären Rückhalt kann kaum die Rede sein und seine Schwester ist ein Junkie – abhängig vom Stoff des Mannes, für den Fresh arbeitet. Sicherlich wirkt allein dieser Storyausschnitt nun wie ein weiterer Vertreter des Hip-Hop-Hood-Films, der in den 1990er Jahren durch Boyz'n the Hood – Jungs im Viertel, Menace II Society und Blood In Blood Out weitreichend florierte. Allerdings ist Boaz Yakin, so sehenswert die genannten Werke auch immer noch sind, nicht daran interessiert, deren stilistische Konventionen zu recyclen.
Fresh lokalisiert sich in seinem Gebaren jenseits aggressiver Rap-Tracks auf der Tonspur und muss seine Figuren nicht im überstrapazierten Ghetto-Slang kommunizieren lassen. Man könnte schon beinahe sagen, dass Fresh etwas Lyrisches, Poetisches mit sich trägt, ohne die Romantik freizulegen, die jenen Charakteristika von Natur aus angedeihen. Im Vordergrund nämlich steht ein kraftvoll dokumentierter Sozialrealismus, der den Zuschauer berührt und gleichermaßen verstört; Der akzentuiert, dass es ein sich selbst regulierendes System im urbanen Kosmos gibt, in dem jedes hehre gesellschaftspolitische Anliegen weitestgehend gescheitert ist. Das System lässt sich von außen nicht verändern, von innen jedoch besteht die Möglichkeit, die vorherrschenden Verhältnisse zu durchbrechen. Und Fresh plant den Ausbruch, möchte jenen Zuständen entfliehen, weil er zu intelligent ist, sich dem Leben auf (und von) der Straße widerstandslos auszuhändigen.
Es befindet sich also auch eine Anklage im Narrativ von Fresh, die sich, ganz generell, an das Land Amerika richtet, in dem Boaz Yakin sein Gesellschaftsportrait ungemein authentisch schildert und die dem Viertel inhärenten Missstände und Brandherde aufzeigt. Darüber hinaus allerdings ist es gerade der Verdienst des wunderbar agierenden Sean Nelson, der Fresh auch zur sensiblen Coming-of-Age-Fabel erhebt und durch sein einfühlsames Spiel Emotionen in den Reihen des Publikums aufflammen lässt, die niemals erzwungen wirken. Famos sind indes auch die Sequenzen, in denen Fresh auf seinen Vater (Samuel L. Jackson, Black Snake Moan) trifft, ein alkoholkrankes Schachass, der dem urbanen Panorama einen metaphorischen Mehrzweck ankoppelt – und in der letzten Szene gnadenlos auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Denn wo ein Problem gelöst scheint, verändert sich nicht die Vergangenheit.
 Trailer
Trailer