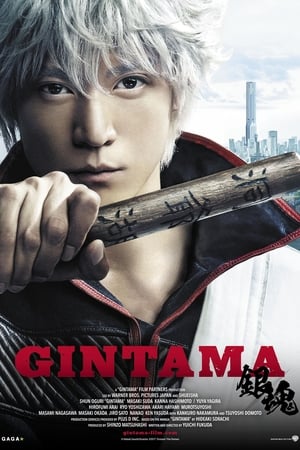Quelle: themoviedb.org


- 100 Min ActionSci-FiKomödieHorrorThriller
- Regie Yoshihiro Nishimura
- Drehbuch Yoshihiro NishimuraSakichi Sato
- Cast Tomori Abe, Kensuke Ashihara
Inhalt
×