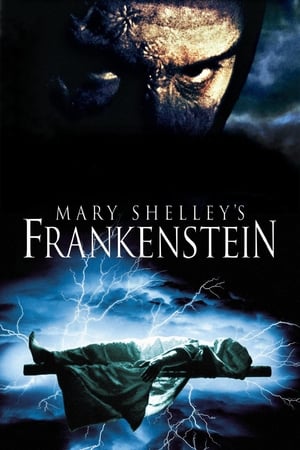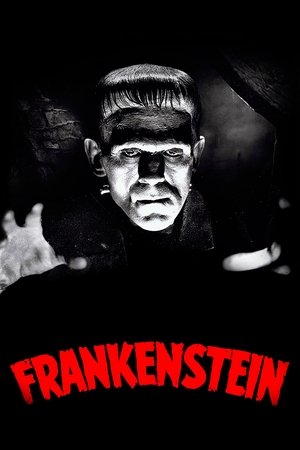In den 90ern kam es zu einer kleinen Renaissance des klassischen Horrorfilms in Hollywood. Nachdem Bram Stoker’s Dracula ein großer Erfolg wurde (inklusive drei Oscars), sah man wohl einen günstigen Moment, um auch Victor Frankenstein und seiner Kreatur einer Frischzellenkur zu unterziehen. Francis Ford Coppola (Der Pate), der bei Dracula noch Regie geführt hatte, war erneut als Produzent tätig, das Drehbuch verfasste Frank Darabont (Die Verurteilten). Da man sich diesmal deutlich enger an der literarischen Vorlage Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley aus dem Jahr 1818 als noch bei Bram Stoker’s Dracula (aber auch jeder anderen Frankenstein-Verfilmung bis dato) orientieren wollte, schien Shakespeare-Anhänger Kenneth Branagh (Henry V.) eine passende Wahl für den Regieposten. Und natürlich besetzte sich dieser gleich selbst für die Hauptrolle des tragischen Anti-Helden Victor Frankenstein. Womit wir schon beim ersten, aber nicht einzigen Problem dieses überaus ambitionierten, an sich sehr interessanten und stellenweise auch durchaus gelungenen Vorhaben wären, das sich in den Detailfragen selbst mehrfach ein Bein stellt.
Wie schon erwähnt, keine der zahlreichen Frankenstein-Adaptionen versuchte auch nur annährend, die Novelle von Mary Shelley sachgerecht wiederzugeben. James Whale’s Frankenstein aus dem Jahr 1931 entlieh sich praktisch nur die Grundidee und die Hauptfiguren. Dieses wurde aber in der Folge so prägend und letztlich populärer als der ursprüngliche Inhalt des Buches, dass sich alle weiteren Interpretationen (wie z.B. die insgesamt siebenteilige Reihe der Hammer-Studios) nur noch daran orientierten. Dies ist die bis heute einzige, echte Verfilmung der Novelle und macht das anfangs ganz ausgezeichnet. So verwendet sie auch die einbettende Rahmenhandlung am Nordpol, als der vom Entdeckerdrang besessene Captain Walton (Aidan Quinn, Legenden der Leidenschaft) dort völlig überraschend auf einen halb erfrorenen Mann trifft, der sich ihm als Victor Frankenstein vorstellt. Dieser berichtet ihm von seiner Lebensgeschichte und ganz ausführlich von dem Part, als seine eigene Passion ihm zu Kopf stieg und er damit den Anfang vom Ende besiegelte.
In der Folge bleibt man sehr dicht an der Erzählung, wandelt hier und da einiges leicht ab (warum, erschließt sich ehrlich gesagt nicht, ist aber anfangs auch nicht zwingend als negativ zu bewerten) und geht teilweise sogar viel deutlicher ins Detail als die ursprüngliche Geschichte. Mary Shelley erzählte aus der Ich-Perspektive, wodurch der Rahmen deutlich kleiner gehalten wurde als im Film. Dieser nimmt sich die Freiheit, gewisse Dinge ausführlicher darzustellen und dementsprechend mit eigenen Ergänzungen auszuschmücken, was in der ersten Hälfte sogar von Vorteil ist und in Kleinigkeiten dem Ganzen etwas mehr Profil verleiht. Da erkennt man eine kreative Auseinandersetzung mit dem Stoff, der über reines Abfilmen hinausgeht und sogar Sinn ergibt. Das soll ausdrücklich gelobt werden. Damit schießt man leider im Finale deutlich über das Ziel hinaus, doch vorher muss man noch auf andere Baustellen zu sprechen kommen.
Der eigentlich luxuriöse Cast ist dabei ein großes Thema. Man sollte annehmen, dass ein Robert De Niro (Wie ein wilder Stier) zur damaligen Zeit praktisch jeder Rolle übernehmen konnte, aber hier haben wir den wohl einzig erdenkbaren Part gefunden, bei dem er unbestreitbar fehlbesetzt ist. Dies liegt in erster Linie nicht an ihm, sondern an der Art und Weise, wie das Drehbuch seine Figur (fehl)interpretiert. Optisch ist er nicht mal in der Nähe der Kreatur, die Mary Shelley beschrieb. Natürlich deutlich menschlicher als noch ein Boris Karloff-Ungetüm, soweit passt die Figurenzeichnung. Allerdings sieht man hier nicht einen furchterregenden Hünen, sondern eher einen durch einige Narben eben nicht ganz hübsch anzusehenden Mann, den man aber kaum als wirklich angsteinflößend oder beeindruckend einstufen kann. Ende des 18. Jahrhunderts gab es wohl noch deutlich erschreckendere Gestalten im alltäglichen Leben. Zudem wird De Niro einfach nicht die Bühne geboten, um sein Method-Acting auch nur ansatzweise zu entfalten. Er müht sich redlich, doch die allgemein immer mehr zu Tage tretende Oberflächlichkeit des Scripts erlaubt ihm gar keinen Spielraum.
Und dann hätten wir noch Kenneth Branagh. Ein narzisstischer Selbstdarsteller wie er im Buche steht. Im Roman gibt es keine Stelle, die beschreibt wie Victor Frankenstein mit nacktem, verschwitztem Oberkörper euphorisiert durch sein Laboratorium fegt, aber das hielt er wohl für künstlerisch unabdingbar und wertvoll. Wenn ihn Marvel gelassen hätte, vermutlich wäre er auch gleich selbst als Thor aufgetreten. Zuzutrauen ist es ihm. Dazu wird alles mit einer affektierten Theatralik aufgeplustert, obwohl man sich dadurch immer weiter vom eigentlichen Kern der Erzählung entfernt. Dies ist aber eben auch der Perspektive geschuldet. Vorher, wie gesagt, ausschließlich aus der ersten Person heraus, wodurch sich weniger mit Äußerlichkeiten, sondern viel intensiver mit dem internen Konflikt beschäftigt wurde. Es ist das Friedhof der Kuscheltiere-Problem. Der Roman von Stephen King war so erschreckend wie brillant, da er sich überwiegend mit der Gedanken- und Gefühlswelt seines Protagonisten beschäftigte und dadurch alle Prozesse und fatale Entscheidungen greifbar und verstörend-glaubhaft gestaltete. Der Film konnte das nicht wiedergeben, da er nur Ereignisse ablichtet. Genau wie hier. Sowohl Frankenstein als auch seine Kreatur kommen dadurch viel zu kurz, obwohl augenscheinlich natürlich alles dargestellt wird.
Das Buch lebte nicht durch seine reine Geschichte, es war die Art, wie sie einem nahegebracht wurde. Dies kann hier nicht so stattfinden und schon hat man ein waschechtes Problem. Hinter seiner schönen Fassade und seinem ganzen, ersichtlichen Aufwand erweist sich Mary Shelley’s Frankenstein nämlich als eines ganz und gar nicht: Erschreckend. Unheimlich. Verstörend. Nur wie eine hübsche Imitation von so etwas. Das, was selbst die „einfachen“ Interpretationen von James Whale oder Terence Fisher trotzdem auf ihre Weise rekonstruieren konnten. Kenneth Branagh liefert ansehnliches Ausstattungskino mit an sich fähigen Darstellern und viel guten Willen im Gepäck, das immer dann beeindruckt, wenn es nur um die optische Präsentation geht. Emotional und erzählerisch ist das steif und teilweise selbstbesoffen banal. Dazu mit einigen Änderungen versehen, die sich besonders gen Ende als deutliche Verschlimmbesserungen herausstellen. Da lässt übrigens wieder Friedhof der Kuscheltiere grüßen. Frank Darabont hat sich wohl echt etwas zu sehr mit Stephen King beschäftigt.
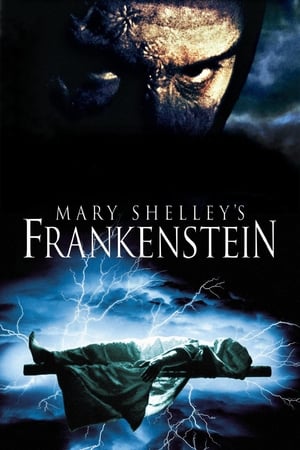 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org