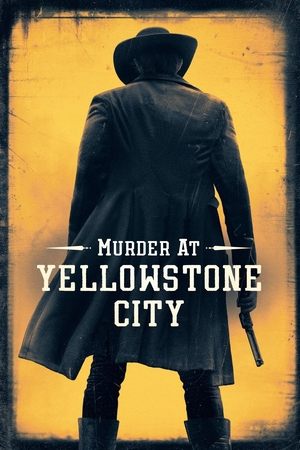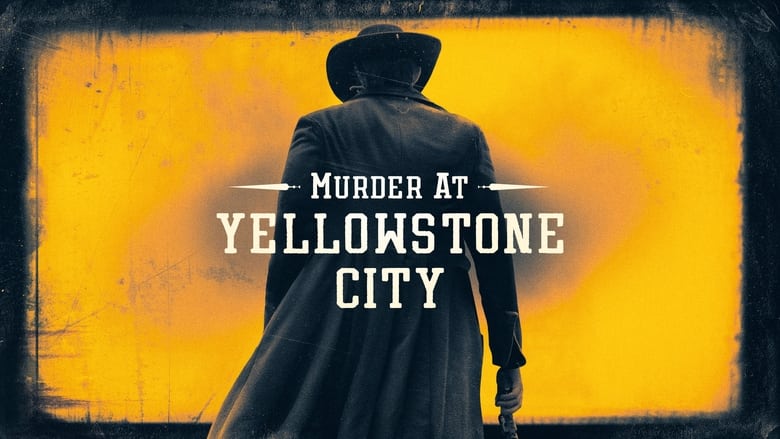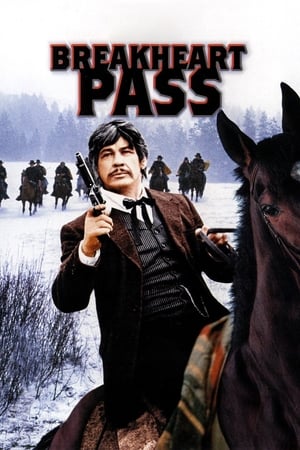Als Westernfan hat man es nicht leicht, gilt das Genre doch schon seit Jahrzehnten als nahezu ausgestorben. Sicher, in sehr unregelmäßigen Abständen gab es immer mal wieder kleine bis sogar größere Lebenszeichen, sie bleiben jedoch stets die Ausnahme von der Regel. Zudem dann auch nicht automatisch von gehobener oder zumindest akzeptabler Qualität, wie zuletzt bei dem furchtbaren The Harder They Fall auf Netflix. An eine Direct-to-Video Produktion wie Mord in Yellowstone City sollte man grundsätzlich keine zu hohen Erwartungen stellen, aber allein die Tatsache, dass es sich hier um ein Exemplar dieser selten gewordenen Gattung handelt, macht ihn beinah automatisch interessant. Bei dem Film des australischen Regisseurs Richard Gray (Robert the Bruce) handelt es sich sogar um einen eher atypischen Vertreter seiner Zunft, was ganz klassisch verliebte Zuschauer*innen vielleicht weniger zusagen wird, ihn in Ansätzen aber sogar noch ein Stück reizvoller gestaltet. Zumindest in der Theorie.
Große Shootouts, malerische Landschaftsimpressionen oder einfach nur der ewige Kampf zwischen Gut und Böse steht hier nämlich nicht im Fokus. Im Grunde genommen könnte die Handlung auch an jedem anderen Ort der Welt und zu einer beliebigen Zeit stattfinden, wird lediglich dem gegebenen Setting entsprechend angepasst. Mord in Yellowstone City ist eine Mischung aus Serienmörder-Thriller und Kleinstadtdrama, dass sich dabei die Rahmenbedingungen des Westerns zu Nutze macht. Als in einer Stadt der Glücklosen plötzlich einer von ihnen zum großen Reichtum kommt und kurz danach ermordet wird, müsste die Liste der potenziellen Täter eigentlich das halbe Einwohnerregister umfassen. Stattdessen wird schnell der farbige Fremde Cicero (Isaiah Mustafa, Es – Kapitel 2) vom verbitterten Sheriff Ambrose (Gabriel Byrne, Hereditary – Das Vermächtnis) als Hauptverdächtiger ausgemacht. Für ihn besteht kein Zweifel an dessen Schuld, selbst als die Indizien eine andere Sprache sprechen.
Die Mixtur verschiedener Genre ist von reichhaltiger Natur und Mord in Yellowstone City hat durchaus seine Momente. Ein besonders überlegter Schachzug ist die Entscheidung, das Whodunnit-Prinzip nicht bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Wenn das Publikum nach gut einer Stunde einen entscheidenden Wissensvorsprung besitzt, gewinnt der Film deutlich hinzu. Da nun nicht mehr die Frage nach dem Täter im Vordergrund steht, sondern was noch geschehen wird, bis es denn auch endlich alle anderen gemerkt haben. Und wer bis dahin noch auf der Strecke bleiben muss. Hier greift das Prinzip, welches schon der große Alfred Hitchcock (Psycho) immer predigte: das Publikum muss mehr wissen als die Figuren. Damit hebt man Spannung wie Intensität deutlich an; kreiert praktisch erst Suspense. In der zweiten Hälfte funktioniert der Film dadurch wesentlich besser. Das es hier auch den ersten und einzigen echten, (doch noch) großen Shootout zu sehen gibt, ist so gesehen nur eine Randnotiz. Mehr oder weniger ein unverzichtbarer Bestandteil des Genres, dafür aber durchaus solide gemacht. Solide, das ist dieses ambivalente Wort zwischen Lob und Kritik, was sich generell dieser Arbeit attestieren lässt.
Solide im positiven Sinne sind in jedem Fall die Darsteller, unter denen sich neben den bereits Erwähnten auch noch so prominente Namen wie Thomas Jane (The Punisher) oder der mit seinen Auftritten immer selten gewordene Richard Dreyfuss (Der weiße Hai) tummeln. Solide ist auch die Inszenierung, wobei hier schon deutlich wird, wie zweischneidig dieses Attribut zu gebrauchen ist. Das ist alles recht ordentlich gemacht, erweckt aber auch nie den Eindruck, als wäre jemals mehr als ein DTV-Titel angedacht gewesen. Das ist stabile Standardkost, die nie durch ihre Darbietung oder Präsentation begeistern oder auch nur reizen kann. Dienst nach Vorschrift. Zu vernünftig, um ernsthaft Angriffsfläche zu bieten, gleichzeitig zu uninspiriert und beliebig, als dadurch in irgendeiner Form besondere Liebe zum Detail, Hingabe oder Kreativität zu vermitteln. Das größte Problem des Films ist jedoch seine Länge bzw. das Unvermögen, damit effizienter umzugehen.
Seine 127 Minuten könnte er nämlich mühelos sinnvoll nutzen, würde er denn mehr auf die zahlreichen und gar nicht mal uninteressant angerissenen Figuren eingehen. Da wäre der Sheriff, der noch um seine Frau trauert und sich um den gemeinsamen Sohn sorgt, was ihn, trotz ehrbarer Ansätze, blind für das eigentliche Geschehen um ihn herum macht. Da wäre der vorschnell verdächtigte Ex-Sklave, der über eine sehr facettenreiche Hintergrundgeschichte zu verfügen scheint, über die wie leider praktisch gar nichts erfahren. Viel besser wird es auch nicht bei der des Priesters (Thomas Jane), der indigenen Stallwärterin, den Prostituierten oder dem gar nicht so geheimen, lediglich geduldeten homosexuellen Salonbetreibern, die aus Furcht eben diesen „Geduldeten-Status“ zu verlieren, ab einem gewissen Punkt sogar ihr Wissen über den Mörder zurückhalten. Sie alle sind interessant, tendenziell sogar vielschichtig, trotzdem weiß der Film sie nur grob zu skizzieren, obwohl er sich doch so viel Zeit nimmt. Diese zieht sich in den ersten 60 Minuten dafür zu deutlich, anstatt damit sinnstiftend umzugehen. In diesem Film steckt erstaunlich viel drin – sogar deutlich mehr als zunächst vermutet -, nur belässt er es überwiegend bei Andeutungen und Oberflächlichkeiten. Das ist bedauerlich, denn hier schlummert vermutlich eine wirklich gute Idee. Die sich schlussendlich brauchbar, in Anbetracht aller Tatsachen aber lediglich mittelmäßig präsentiert.