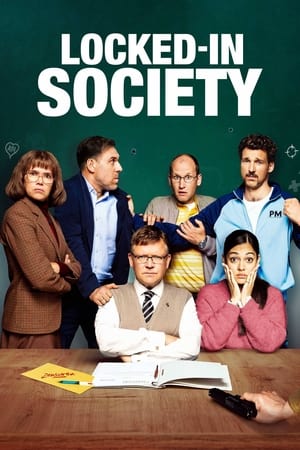Florian David Fitz (Der Spitzname) ist längst nicht mehr nur Schauspieler, sondern ein Markenname für eine bestimmte Art deutschen Wohlfühlkinos: sympathisch, leicht melancholisch, mit einem Hauch von Lebenskrise, aber stets so konzipiert, dass am Ende die Sonne wieder scheint. In No Hit Wonder spielt er nicht nur die Hauptrolle, sondern zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich und war als "kreativer Produzent" beteiligt - aha. Regie führte Florian Dietrich (Toubab), doch der Film trägt unverkennbar Fitz’ Handschrift – inklusive jener Tendenz, selbst die tiefsten seelischen Abgründe in hübsche Bilder und süffige Dialoge zu verwandeln.
Daniel (Fitz) ist ein Mann, der einst mit einem einzigen Popsong berühmt wurde – und seitdem nicht mehr weiß, wer er ohne diesen Hit eigentlich ist. Nach einem Suizidversuch landet er in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Dort begegnet er Dr. Lissi Waldstett (Nora Tschirner), die sich wissenschaftlich mit dem Thema Glück beschäftigt. In einer Mischung aus Therapie und Feldexperiment schlägt sie Daniel vor, eine Gruppe von Menschen mit psychischen Problemen zu betreuen – durch gemeinsames Singen. Der Chor soll Heilung bringen, Selbstvertrauen schaffen und das Leben der Teilnehmer verändern.
Was auf dem Papier nach einem charmanten Ansatz klingt, erweist sich auf der Leinwand als erstaunlich formelhaftes Unterfangen. No Hit Wonder will gleichzeitig Trost spenden, unterhalten und die Kraft der Musik feiern – und verliert dabei den Blick für die Wirklichkeit, die er zu Beginn noch ernsthaft streift. Psychische Erkrankungen, Einsamkeit und soziale Ausgrenzung werden zwar angerissen, doch nie wirklich durchdrungen. Stattdessen dient das Leiden der Figuren oft nur als dramaturgischer Zündstoff, um auf schnellstem Wege zu einem weiteren Moment der emotionalen Erlösung zu gelangen.
Die meisten Nebenfiguren bleiben bloße Schablonen: Hier die alleinerziehende Mutter aus prekären Verhältnissen, dort der gutmütige Arbeiter mit großem Herz, dazwischen ein paar Statisten, die kaum mehr als Namen tragen. Es ist, als würde der Film seine Figuren in Kategorien sortieren, um sie anschließend im Chor der Lebensfreude harmonisch verschwinden zu lassen. Individuelle Geschichten gibt es ein paar, innere Widersprüche oder gar Ambivalenzen haben in dieser Partitur aber keinen Platz.
Dabei steckt in der Ausgangsidee durchaus Sprengkraft. Ein Mann, der einst berechnend einen Hit komponierte, um das Popgeschäft zu entlarven, wird selbst zum Opfer seiner Schöpfung – und erlebt nun, wie dieselbe Simplifizierung in der Glücksforschung und Gruppentherapie wiederkehrt. Doch anstatt diesen Widerspruch als zentrales Thema zu nutzen, begnügt sich No Hit Wonder mit hübschen Momenten und gefälligen Dialogen. Die Szenen wirken präzise gebaut, aber nie lebendig; man spürt die Absicht, nicht das Gefühl.
Der Film steht symptomatisch für das, was Daniel in einer Schlüsselszene über seinen Song sagt: Wer die richtigen Knöpfe drückt, wer die Formel kennt, kann mühelos einen Hit erzeugen. Fitz und Dietrich beweisen mit No Hit Wonder, dass das auch im Kino funktioniert. Das Ergebnis ist sauber inszeniert, nett gespielt und konturlos – ein Wohlfühlprogramm, das behauptet, von Schmerz zu erzählen, ohne ihn je wirklich zuzulassen. In einem Film, der vom Glück spricht, bleibt am Ende vor allem eines: die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit – nach jenen Zwischentönen, die zwischen Euphorie und Verzweiflung liegen und die No Hit Wonder so beharrlich übertönt.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org