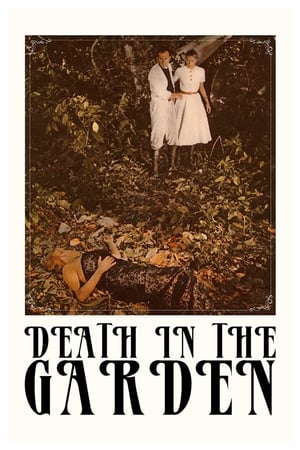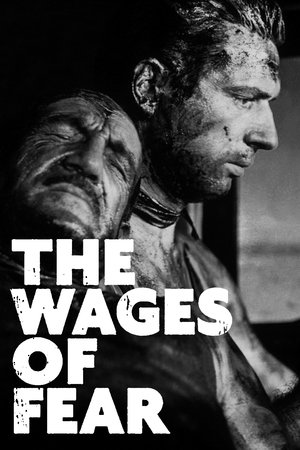Pesthauch des Dschungels stellt in der Vita von Meisterregisseur Luis Buñuel (Der diskrete Charme der Bourgeoisie) ein eher untypisches Werk da, welches wesentlich konventioneller ausfällt als die meisten Arbeiten des für seinen Surrealismus bekannt gewordenen Filmemachers. Den französischen Produzenten schwebte ein Abenteuerfilm im Stil von Henri-Georges Clouzot’s Meisterwerk Lohn der Angst (1953) vor. Parallelen sind allein aufgrund des Settings in einem fiktiven südamerikanischen Land, der Konstellation der Hauptfiguren (allesamt Europäer und mehr oder weniger desillusionierte Glücksritter) und dem letztlichen Survival-Part in der zweiten Filmhälfte unübersehbar vorhanden. Mal ganz abgesehen von Hauptdarsteller Charles Vanel (Die Teuflischen), der in beiden Filmen eine gewichtige Rolle spielt. Als Grundlage diente ein Roman von José-André Lacour aus dem Buñuel gemeinsam mit Raymond Queneau und Luis Alcoriza ein Drehbuch verfasste. Die eher kommerzielle Veranlagung wie die sehr gradlinige Grundlage erlaubten dem Regisseur kaum, seinen sonst bevorzugten Stil auszuführen.
Nur ganz kurz, im letzten Drittel, lässt Buñuel einen leicht surrealen Einschlag aufblitzen, was sich aber wirklich auf klitzekleine Momentaufnahmen beschränkt, die den Film allgemein aber kaum beeinflussen oder anderweitig prägen. Die Auslegung ist ganz klar, einen massentauglichen Abenteuerfilm auf die Beine zu stellen, der aber immerhin eine politische Note enthält, wobei sich vermutlich eine Kritik an der Franco-Diktatur in seinem Geburtsland Spanien hineininterpretieren lässt. Ein totalitäres Militärregime – eine übergeordnete, staatliche Führungsetage lässt sich nicht ausmachen – übt Druck auf das verarmte Proletariat aus und nimmt den hauptsächlich eh nicht sonderlich erfolgreichen Diamantenschürfern ihre Existenzgrundlage. Bis es zur Eskalation des Konfliktes und zum eigentlichen Mainpart des Plots kommt, nimmt sich Pesthauch des Dschungels – auch hier eine deutliche Referenz zum ähnlich vorgehenden Lohn der Angst – angenehm viel Zeit, um erst mal die Charaktere und ihre Beweggründe vorzustellen. Von den 100 Minuten Laufzeit wird gut die Hälfte dafür investiert, bevor es nur in die Nähe des titelgebenden Regenwaldes kommt.
Da wäre Castin (Charles Vanel), einer der Diamantenschürfer, der im Gegensatz zu seinen aufbrausenden Kollegen nicht mit Gewalt gegen die Unterdrückung durch die Armee antworten will. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat er Pläne für die Zukunft: mit seinem Ersparten will er zurück nach Frankreich, um ein Restaurant zu eröffnen. Gemeinsam mit seiner taubstummen Tochter Maria (Michèle Girardon, Hatari!) und Djin (Simone Signoret, Armee im Schatten), die hier als Prostituierte arbeitet. Die toughe Frau hegt zwar keine amourösen Gefühle für ihn, aber letztlich will auch sie nur endlich da raus und der angenehme Castin scheint ein geeignetes Ticket. Ebenfalls nicht auf die Konfrontation bedacht ist der Missionar Lizardi (Michel Piccoli, Topas), der verzweifelt versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln. Ganz anders gepolt ist da der plötzlich auftauchende Chark (Georges Marchal, Belle de jour – Schöne des Tages). Ein Outlaw und notorischer Unruhestifter, der die hitzige Situation zusätzlich befeuert. Rund eine Dreiviertelstunde kann als reine Einleitung betrachtet werden, was aber der Zeichnung von Figuren und Umständen nicht nur immens guttut, sondern auch unabhängig davon sehr kurzweilig ausfällt. Alles ist interessant, alles ist jetzt schon hervorragend inszeniert und vor allem sehr gut gespielt. Der Cast ist ein großer Pluspunkt dieser Produktion, die erst nach fast einer Stunde sich dem eigentlichen Mainplot widmet.
Der – nenne wir es mal – Survival-Part profitiert enorm von der vorher so ausführlich betriebene Charakterzeichnung, da er nun nicht mehr so viel Zeit investieren muss, um relativ schnell vorangetriebene Prozesse als glaubhaft darzustellen. Er kann sich viel mehr auf das eigentliche Geschehen konzentrieren und was vermutlich anderweitig beinah ad hoc erscheinen würde, ergibt so absolut Sinn. Jetzt, inmitten des ausweglos scheinenden Überlebenskampfs, muss nicht mehr erläutert werden, warum dieser oder jener entsprechend reagiert, es ist eine logische Konsequenz. Das ist ein vielleicht nicht sofort ersichtlicher, schlussendlich aber klug konzipierter Vorteil, da selbst extrem anmutende Situationen als solche vollends funktionieren. Ohne nochmal eine Stunde an Erklärungen hinzu basteln zu müssen, was das Finale nur unnötig aufblähen würde. Trotz all dieser deutlichen Qualitäten wirkt Pesthauch des Dschungels unterm Strich eine Spur zu zaghaft, denn sowohl das Szenario als auch die vorhandenen Ressourcen würden Spielraum für ein echtes Meisterwerk zulassen. Es ist sowohl zu erkennen, dass Buñuel kommerzielle Kompromisse eingehen musste, als auch dass man nur verlegen auf die Intensität schielt, die das große Vorbild Lohn der Angst bis heute zu einem der besten Filme aller Zeiten macht. Da hängen die Trauben halt viel zu hoch.
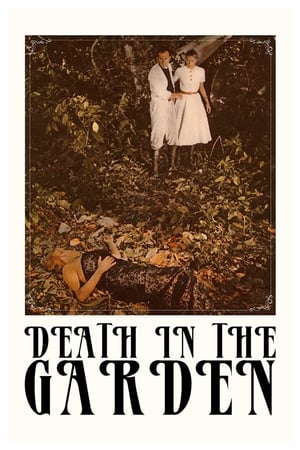 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org