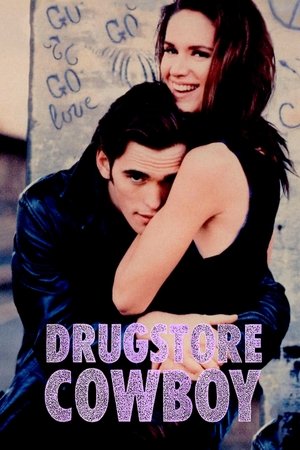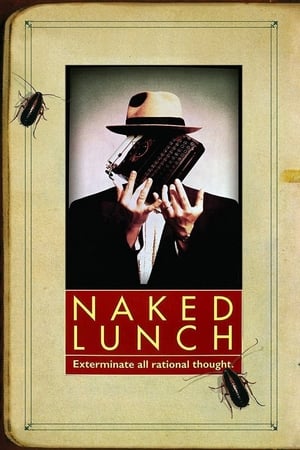„Niemand ist jemals wirklich allein, du bist Teil von allem Lebendigen. Die Schwierigkeit besteht darin, jemanden davon zu überzeugen, dass er wirklich ein Teil von dir ist.“ Als Luca Guadagnino als 17-jähriger Jugendlicher auf den Straßen Palermos entlangschlenderte, waren es auch diese Worte, die sich dem italienischen Kultregisseur bald schon einschrieben. Sie stammen aus dem Jahr 1952, entsprungen der Feder William S. Burroughs‘, der seit 1949 mit seiner Quasi-Ehefrau Joan Vollmer und deren Tochter in Mexico City lebte. „Queer“, so viel stand bereits damals fest, sollte der Titel des Manuskripts sein, das Burroughs 1952 schrieb, dem Jahr, nachdem er seine Frau erschossen hatte. Wer sich Guadagninos Queer ansieht, muss darüber, und über die vielen anderen autobiographischen Details aus dem Leben Burroughs, nicht notwendigerweise unterrichtet sein. Ist man indes erst einmal darüber im Bilde, so weist Guadagninos Ansatz klare Ähnlichkeiten zu Werken wie Paul Schraders Mishima oder Andreas Kleinerts Lieber Thomas auf, die beide — mehr oder weniger effektiv — auf ähnliche Weise Biographie und literarisches Werk miteinander verschmelzen.
Ein entscheidender Hinweis hierauf findet sich bereits im Casting. Denn während der Protagonist Lee bei Burroughs, analog zum Autor selbst zum Zeitpunkt der Manuskript-Entstehung, Ende 30 ist, kommt er bei Guadagnino, dessen Wahl auf Daniel Craig (Knives Out) fiel, auf nahezu doppelt so viele Lebensjahre. Gewissermaßen liefert Burroughs selbst einen Anhaltspunkt für diese Entscheidung Guadagninos. Im Vorwort, das Burroughs der mehr als dreißig Jahre verspäteten Erstveröffentlichung Queers voranstellte, vergleicht er die Entzugserscheinungen eines „Junk“-Abhängigen mit den physiologischen Gegebenheiten von Männern in ihren 60ern, die feuchte Träume und spontane Orgasmen erleben würden. Dass Lee, der bereits in Burroughs‘ Debütroman Junky Protagonist war, nun wie ganz und gar verändert scheine, könne, so Burroughs, nur dann vollends verstanden werden, wenn man sich dieses Umstandes gewahr werde. Und weiter heißt es da noch: Junky sei ein Roman der Abhängigkeit gewesen, Queer einer des Entzugs. Eine autorische Losung, der Burroughs-Experte Oliver Harris etwas Entscheidendes hinzufügt. In den Augen Harris‘ sei Junky viel mehr ein Roman weg vom Begehren, während sich der darauffolgende Queer diesem zuwende.
Dies führt uns nun schließlich wieder zu Guadagnino zurück, der wie kaum ein anderer populärer Gegenwartsregisseur regelmäßig das dieser Tage allzu oft marginalisierte menschliche Begehren auf die große Leinwand projiziert. Und wenngleich sich die Kontinuitätslinien zu Guadagninos großem Erfolg Challengers auf den ersten Blick in Grenzen halten mögen, so setzt sich in der Geschichte um Lee—einem amerikanischen G.I., der sich in der Nachkriegszeit dank üppiger Veterans Benefits in Mexico City eingerichtet hat—Guadagninos Interesse an den Hierarchien fort, die der Begehrensstruktur zwangsläufig innewohnt. Verkörpert wird dieses Paradigma durch Lee, dessen auch durch Drogenkonsum und stetiges Cruising kaum zu lindernde Ennui durchbrochen wird, als er die Bekanntschaft Eugene Allertons (Drew Starkey, Love, Simon) macht, eines nur sporadisch beschäftigten Journalisten in den frühen Zwanzigern, den er bald schon auf eine Südamerikareise einlädt, um das sagenumwobene Yage zu finden, das vor allem eines Verspricht: Telepathie, und mit ihr das Überkommen der ontologischen Einsamkeit.
Dass Guadagnino für sein Objekt der Begierde mit Drew Starkey auf ein recht unverbrauchtes Gesicht zurückgreift, unterstreicht auf geschickte Weise, wie dieser angelegt ist: unaufgeregt, gleichmütig und letztlich unnahbar. Ein unbeschriebenes Blatt, für Lee wie für uns. Gleichwohl für Lee inmitten dieser enigmatischen Aura allem voran eine Frage im Vordergrund steht: „Do you think he’s queer?“ Dieser Begriff, der unserer Gegenwart so selbstverständlich angehört, hat im Laufe der Geschichte eine bemerkenswerte Umdeutung durchlaufen, war seinerzeit aber vor allem ein Begriff, der sich auf homosexuelle Männer bezog. Guadagnino deutet dies kurz an, indem er eine Passage des Romanes aufgreift, in der in einer der von Lee tagtäglich frequentierten Bars unmissverständlich die abwertende Konnotation des Wortes „homosexuell“ dargelegt wird. Bedauerlicherweise geschieht dies so beiläufig, dass angenommen werden muss, dass sich Guadagnino mehr für die Repräsentation der Romanvorlage interessiert, als diesen mit unserer Gegenwart in Beziehung zu setzen.
Die Gegenwart existiert bei Guadagnino selten, ist immer nur in jenen Momenten erreichbar, da seine Figuren einander näherkommen, die Zeit sich verdichtet. Folgerichtig sind es gerade die Szenen, in denen die Kostümierung, die Ausstattung, der Kontext zusammenstürzt, von Hahnenkämpfen weggeblendet wird, in denen Queer am meisten zu sich findet. Das Narrativ — so viel ist nicht nur den bisherigen Werken des Italieners selbst zu entnehmen, sondern auch dem Umstand, dass die erfolgreiche Phase seiner Karriere erst einsetzte, nachdem er Abstand vom Drehbuchschreiben nahm — ist bei Guadagnino von vernachlässigbarer Bedeutung. Folgerichtig sind es auch in Queer die inszenatorischen Freiheiten, die den Film zumindest hin und wieder von der Vorlage abheben lassen, Momente etwa, in denen das Jetzt auf vergebliche Weise in Slow-Motion festzuhalten versucht wird; Visionen einer utopischen zweisamen Einsamkeit, die die interpersonellen Grenzen auflösen, die uns Lees innigste Sehnsucht verbildlicht.
Irritierend ist indes die künstlerische Konzeption des in den römischen Cinecittà-Studios rekreierten New Mexicos, das—mit seiner spärlichen Bewohntheit und den pappmaché-artigen Häuserfassaden—in beinah jeder Einstellung an seine eigene Künstlichkeit erinnert. Die Implikationen dieses Umstandes werden allerdings nicht nennenswert diskutiert und drücken vor allem Unentschlossenheit aus. Was zum Feature hätte gereichen können, verkommt auf diese Weise zum Bug. Wenn Guadagnino Metareflexionen vornimmt, so spiegeln sich diese nicht auf ihn zurück, sondern auf Burroughs. Beispielhaft dafür steht die Entscheidung, den Willhelm-Tell-inspirierten Schuss, mit dem Burroughs versehentlich seine Frau Joan Vollmer in die Stirn traf und tötete, im Film aufzugreifen. Ganz so wie die Tranzluenz, mit der Guadagnino hier motivisch arbeitet, zeigt sich auch das Narrativ und letztlich Burroughs Autorschaft an diesen Stellen durchscheinend.
Im 1985er Vorwort seines Jahrzehnte zuvor geschriebenen Kurzromans schreibt Burroughs: „One wonders if Yage could have saved the day by a blinding revelation“. Dass „man“—dass Burroughs—sich tatsächlich fragt, ob die Droge, nach der Lee und Allerton in Südamerika suchen, den beiden tatsächlich Erleuchtung gebracht hätte, davon ist nicht auszugehen. Allerwenigstens nicht für Luca Guadagnino, der sich dahingehend im letzten Drittel entschieden von der Buchvorlage löst. Lees letztliche Einsamkeit, derer er sich nach dem Fortgangs Allertons aufs Niederschmetterndste gewahr wird, speist sich bei Guadagnino nicht aus dem Scheitern der gemeinsamen Mission, vielmehr entsteht sie trotz deren Gelingens und der bewusstseinseröffnenden Wirkung des Malpighiengewächses. Gewissermaßen verleiht diese Drehbuchentscheidung den Figuren mehr Profil: Allerton, auf dessen Verschwinden in der elliptischen literarischen Vorlage erst in der Retrospektive Bezug genommen wird, wird bei Guadagnino in all seiner Unsicherheit bezüglich seiner sexuellen Identität dargestellt. „Wovor fürchtest du dich nur so?“, fragt die von Leslie Mann (Phantom Thread) gespielte Doktorin Allerton nach dessen psychedelischen Grenzerfahrung, die ihn, gerade weil der Rausch ihn so nah an Lee bringt, ihn in der Folge umso stärker von ihm abstößt. Die Tür, so fährt sie fort, sei nun schließlich aufgestoßen. Jene Tür, so viel suggerieren die Worte der Doktorin auf unzweideutige Weise, hängt in den Angeln des idiomatischen ‚Closets‘, in den sich Allerton in der Öffentlichkeit noch immer einschließt. In der direkten Gegenüberstellung Lees und Allertons erklärt sich uns somit leicht, bei welcher Figur Guadagninos Sympathien liegen. Vielleicht ein bisschen zu leicht.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org