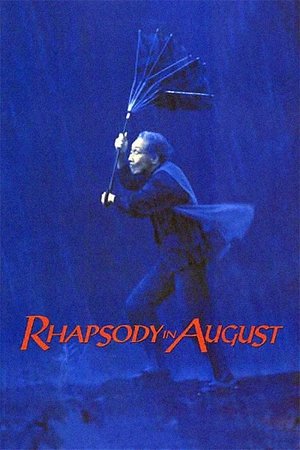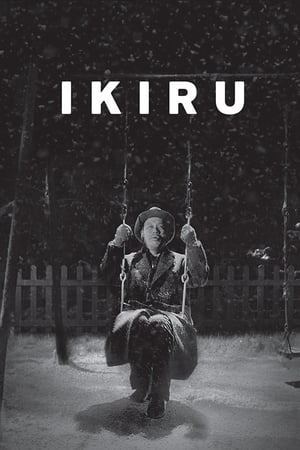Der japanische Meisterregisseur Akira Kurosawa ist für vielerlei Filme und Dinge bekannt; für seine Großwerke in seiner überragenden Karrierephase in den 50er Jahren (Die sieben Samurai, Rashomon, Ikiru) oder seine poetische und aussagekräftige Bildsprache. Doch waren die 50er wohl auch seine kreativste Phase. So entstanden in der Dekade ganze neun Spielfilme, in den 60ern waren es nur noch fünf Werke, in den 70ern und 80ern je zwei. Filmemacher von diesem Kaliber, jene, die fast schon eine neue Ideologie der Filmsprache entfachten, sollte man auf keinen Fall auf ein paar Werke beschränken. Viel mehr sollte es Ziel sein, sich auf alle Werke aus jeder Phase der Karriere zu konzentrieren. Das Spätwerk vieler Regisseure steht dabei in einer allgemeinen Betrachtung unter einem anderen Stern; altersmüde, ruhige, vielleicht gar weise Werke stehen dort an der Tagesordnung. Manch einer sagt gar, die letzten Werke seien stets die schlechtesten. William Friedkin lacht denen bestimmt ins Gesicht.
Kurosawa allerdings hat mit Rhapsodie im August (seinem vorletzten Film aus dem Jahr 1991, nur Madadayo (1993) kam dann noch) einen Film abgeliefert, der in mehrerer Hinsicht klar als Alterswerk identifizierbar ist und dennoch nichts an der Schärfe von seiner Filmkunst einbüßen musste. Das Großartige dabei ist, dass Kurosawa selbst all das am meisten bewusst ist. Erkennbar wird das zum Beispiel schon zu Beginn. Sehr oft eröffnete der meishu seine Filme im strömenden Platzregen, bei Dunkelheit. Der Boden zur matschigen Masse aufgequollen, der Mensch stets von der Gefahr des Versinkend bedroht, Schwärze, Dreck und Moder bestimmt das Leben. Es ist ein zutiefst pessimistisches Nachkriegsjapan gewesen, das Kurosawa auf Zelluloid bannte. Die Wut im Bauch war ihm stets anzumerken. Hier hingegen beginnt der Film mit weißen Bauschewolken am blauen Himmel. Dieses Japan, dieser Kurosawa ist ein anderer als jener in den 50ern. Die Amerikaner und Japaner haben sich angenähert, der kulturelle Austausch funktioniert und floriert und Kurosawa zeigt hier keine emotionale Reaktion mehr, sondern agiert vorausschauend, ruhig. Wehmütig zwar, aber selbstuntersuchend.
Es wirkt teilweise so, als hätte Kurosawa hier eher einen Film abgeliefert, der stilistisch an seinen großen Konkurrenten Yasujiro Ozu (Die Reise nach Tokyo) erinnert und als sei seine frühere Wut dem alterweisen Weltschmerz gewichen. In der globalisierten Welt der 90er Jahre ergibt Nationalismus keinerlei Sinn. Und während Japan die Atombomben zwar nicht vergessen oder verzeihen mag, bringt es nichts, die Nachkriegsgenerationen mit der Schuld ihrer Vorfahren zu belasten. Die japanischen Kinder tragen Shirts mit Aufdrucken von New York oder dem MIT, ihre Eltern sind auf Hawaii und treffen sich mit amerikanischen Staatsbürgern (u.a. gespielt von Richard Gere, der hier auch Japanisch spricht). Die Kinder leben derweil bei ihrer Großmutter, die ihren Mann damals in Nagasaki verlor und noch immer trauert, hasst und mit einem Schirm durch die Welt schreitet, um sich vor der Strahlung zu schützen. Kurosawa nähert sich hier auf eine andere Art und Weise den Erlebnissen des Krieges; er bezieht ihn direkt mit ein und umschreibt ihn nicht nur. Dafür kocht keine Wut mehr in ihm, viel mehr ist er von Unglaube geprägt und lässt seine Hauptfiguren würdevolle Erinnerungs- und Demutsarbeit leisten.
Die Kinder nämlich machen sich auf die Suche nach der Vergangenheit ihrer Familie, sie suchen den Grund, weshalb die Oma nicht zu ihrem Bruder nach Hawaii möchte. Sie suchen den Grund, weshalb die Oma die Amerikaner verabscheut - und landen auf einem Schulgelände, bei einem verrosteten und verbogenen Klettergerüst, das dem Druck der Atombombe nicht ganz Stand halten konnte. Es sind hier alles Originalschauplätze, die gezeigt werden und die Luft der Historie aus jeder Pore atmen, Denk- und Mahnmäler aus aller Welt und eben dieser Schulhof mit dem Klettergerüst. Der Opa wurde nie gefunden, merkt eines der Kinder an. Deshalb müsse er doch eigentlich noch da sein. Die Kinder nehmen daraufhin ihre Hüte ab und schweigen, zollen Tribut vor dem zerstörten Klettergerüst, einem spaßigen Zeitvertreib für Kinder. Spaß und Leben, das zu Staub zerfiel. Kurosawa beweist noch immer seine große Klasse für Bildsprache, seine meisterhafte visuelle Kunstfertigkeit, und lässt hinter den Kindern eine Staubwolke durch das Bild ziehen. Bilder, vor denen man sich nur verneigen kann. Bilder, die einem die Augen öffnen und das Herz brechen können.
Rhapsodie im August reiht Momente hintereinander, Sekunde um Sekunde, und lässt seine jugendlichen Protagonisten die Vergangenheit erlernen. Sie versuchen, zu verstehen, sie versuchen, das Auge der Atombombe, den Pilz, zu sehen. Das Auge, das die Menschen blendet, ihnen ihre Geschichte, Gedanken und Zukunft nimmt. Kurosawa braucht hier keine komplizierten Bildkompositionen mehr, nur noch ausdrucksstarke. Und derlei findet er immer wieder. Amerikaner und Japaner vereint an Denkmälern, der Erinnerung, Buße und des Wehmutes wegen. Auf dem Weg zur positiven Veränderung. Während die Erwachsenen gedenken, spielen im Hintergrund Kinder auf dem Schulhof, schließlich haben sie Pause. Sie haben an dem Unrecht ebenso wenig Schuld wie ihre gleichaltrigen amerikanischen Kompagnons. Sie wachsen auf in einer besseren Generation, einer besseren Welt. Das Auge der Atombombe wird dann konsequenterweise durch den Mond ersetzt, der in einer stillen Nacht erscheint, in der nichts als Dankbarkeit und Gemeinsamkeit gelebt wird.
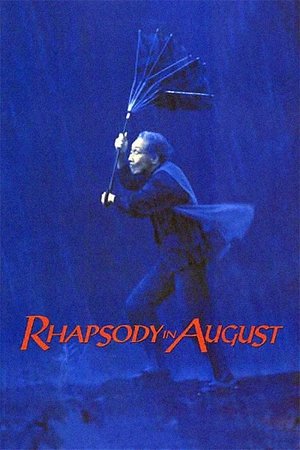 Trailer
Trailer