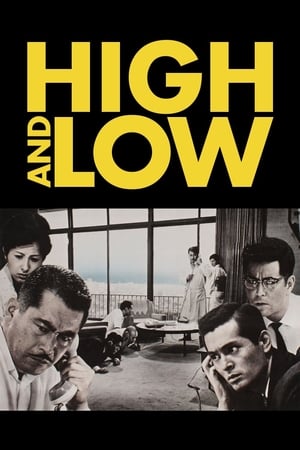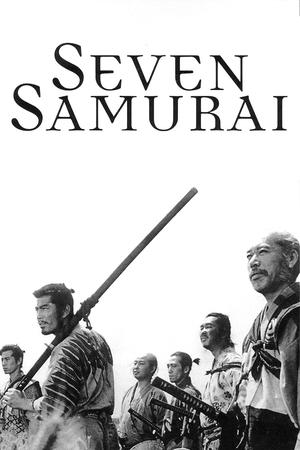Für viele beginnt der kinematische Horizont des japanischen Großmeisters Akira Kurosawa im Jahr 1950, als er, sein langjähriger Kollege Toshiro Mifune und ihr Film „Rashomon“ weltweit berühmt wurden, das Kino nachhaltig prägten und sogar mit dem Begriff „Rashomon-Effekt“ in die wissenschaftliche Sprache eingingen. Was Kurosawa nach dem Film noch ablieferte, dürfte weitestgehend bekannt sein, schuf er doch nur vier Jahre später mit „Die sieben Samurai“ einen weiteren Klassiker des Weltkinos und setzte 1961 mit seinem Film „Yojimbo“ den Startschuss für den alsbald aufkeimenden Italo-Western. Ja, Kurosawa und seine Arbeit sind gewissermaßen unvergleichlich, sein Erfolg und Können unbestritten. Dass er aber auch vor 1950 schon bereits einige großartige Filme abgeliefert hat, ist nicht so bekannt. Zum Beispiel sein Kriminalfilm mit Anleihen an den Film Noir der USA, der den Titel „Ein streunender Hund“ trägt und als Vorreiter für den modernen Buddy Cop-Film gilt.
Kurosawa selbst empfand den Krimi lange für einen weniger gelungenen Film. Ganz der selbstkritische Filmemacher, behauptete er, man sehe dem Film zu sehr an, wie viel Wert man auf die technischen Aspekte gelegt hatte. Später revidierte er diese Meinung und schloss sich der breiten Masse an, die dem Film positiv gestimmt war. Dass er noch Frieden mit diesem Film geschlossen hat, ist da natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, doch täte es, wenn Kurosawa den Film nie zu schätzen gelernt hätte, der Qualität des Werkes keinen Abbruch. Das japanische Nachkriegskino zeichnet sich oft durch selbstkritisches und orientierungsloses Philosophieren aus. Der eingangs erwähnte Film „Rashomon“ setzt sich sehr genau mit der Wahrheit, Perspektivität, Ehre und Moral auseinander - bezieht das aber nie direkt auf den Zweiten Weltkrieg, weil die Handlung viel früher stattfindet. Die Figuren in „Ein streunender Hund“ hingegen erwähnen den Krieg, die Überlebenden, die Veteranen und sinnieren in ihrer blassgrauen Art und Weise über ihre Sicht der Welt. Die Orientierung an der Schwarzen Serie passt da wie die Faust auf das Auge.
Die Handlung spielt in Tokio in den späten 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, während die Bevölkerung unter der brennenden Hitze des überraschend heißen Sommers zu zerfließen droht. Es ist diese Hitze, die einem jegliche Feuchtigkeit aus dem Körper saugt, die Seele brät und jeglichen Antrieb aus dem Körper verbannt. Einer dieser Tage, an denen man nicht zu lange aufrecht stehen kann, sich die Haut verbrennt und einem die schwüle Luft das Blut aus dem Kopf und den Sauerstoff aus der Lunge saugt. Der Protagonist heißt Murakami (Toshiro Mifune, „Die sieben Samurai“) und ist den ganzen Film hindurch schweißgebadet. Alle anderen schwitzen zwar, wischen sich aber regelmäßig mit einem Tuch trocken oder fächeln sich Luft zu. Murakami nicht, er schwitzt sein Hemd und sein Jackett durch, ihm scheint nicht aufzufallen, dass seine Haare in langen Strähnen sein Gesicht verdecken. Irgendwann lässt sich nicht mehr sagen, ob der Schweiß bloßes Produkt der Hitze ist, oder nicht doch von dem Stress herrührt, dem der Polizist ständig ausgesetzt ist, nachdem ihm seine Dienstwaffe im Bus gestohlen wird.
Die vollen zwei Stunden des Films wird Murakami auf der Jagd nach seiner gestohlenen Waffe sein, dabei auf eine Bande treffen, die systematisch Diebstähle betreibt und von der Möchtegern-High Society in die Unterschicht so ziemlich jede Seite der Stadt besuchen. Viele Momente in der ersten Hälfte des Films und den wichtigsten Punkt des Finales erzählt Kurosawa mit Großaufnahmen von Füßen. Wenn Murakami bei der dienstlichen Schießübung versagt und danach allein und frustriert davonstampft, löst er bei jedem seiner Schritte einen kleinen Sandsturm aus, lässt er mit jedem Schritt einen Staubwirbel unter seinen Schuhen aufsteigen. Füße bzw. Schuhe tauchen hier immer wieder auf, werden um die zehnmal in Großaufnahmen gezeigt, wie sie durch die sandigen Straßen Tokios schreiten, verharren, zögern, hetzen. Sie verleihen den Menschen Mobilität, Ambivalenz und Gleichgewicht, aber sie sind es auch, die die Menschen ins Verderben führen. Wenn Pech einen Mann ausmachen oder ihn zerstören kann, dann zählt das gleiche für die Füße.
Die Füße sind es schließlich auch, die Murakami den ganzen Film über von einem Ort zum nächsten hetzen werden. Trotz seiner Länge von zwei Stunden wirkt der Film enorm atemlos, auch wenn er sich in der zweiten Hälfte immer mal wieder Zeit zu nehmen scheint. Der Polizist klappert Haus um Haus ab und jagt erst die eine verdächtige Person, bekommt von der neue Information für die Person, bekommt von ihr wiederum ebenso Informationen und so weiter. In der ersten Stunde des Films nutzt Kurosawa unzählige Close-Ups und Detailaufnahmen, lässt schnelle Überblendungen und atemlose Verhöre aufeinander folgen. In der zweiten Hälfte des Films hingegen folgen sehr ähnliche und langsamer erzählte Episoden aufeinander. Das ist nicht immer vollends elegant gelöst und schrammt teils haarscharf an lästigen Wiederholungen vorbei, wenn Kurosawa nicht derart versiert in seinem Umgang mit dem Gezeigten wäre. Er weiß nämlich sehr genau, wie lange er was ausreizen darf, ohne die Gunst des Zuschauers zu verlieren. Und er zeigt System, wenn er die verschiedenen aber ähnlichen Szenen einem gleichen Aufbau unterzieht und am Ende das Leid der Menschen mit ihrem fröhlichen Umfeld kontrastiert. Sei es die schnelle Jass-Musik oder das jubelnde Publikum bei einem Baseball-Spiel.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org