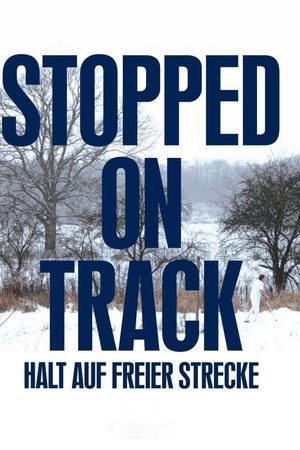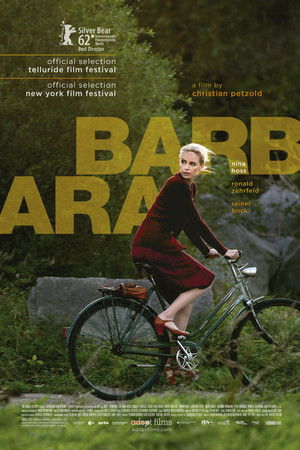Der stille Schmerz des Sterbens dräut hier in jeder Einstellung. Selbst in den Momenten, in denen Sven (Lars Eidinger, Die Blumen von gestern) sein ganzes Krebsleiden aus seinem Körper brüllt, trampelt und wimmert. Schwesterlein bleibt ein in sich gekehrter, ein leiser Film, weil Sven zwar der Katalysator der Handlung ist, im Zentrum der Geschichte allerdings steht Lisa (Nina Hoss, Phoenix), die alles dafür gibt, um ihrem zwei Minuten älteren Zwillingsbruder das Leben zu retten. Nicht nur durch Blut- und Knochenmarkspenden, sondern auch durch die aufopferungsvolle Bereitschaft, die eigene, zuvor abgewürgte künstlerische Energie zu kanalisieren, um einem geliebten Menschen vor seinem sicheren Tode nicht auch noch um seine Leidenschaft zu bringen. In Schwesterlein geht es daher auch nicht wirklich um die Angst vor dem Sterben.
Es geht vielmehr um die urwüchsige Bedingungslosigkeit, die ein Mensch aufbringen kann, um seine Liebsten so wohltuend wie nur möglich in den Tod zu begleiten. Das genügt letzten Endes auch aus, um den Berlinale-Beitrag von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond zur sehenswerten Seherfahrung zu erheben. Darüber hinaus, all die konfliktgeladenen Nebenkriegsschauplätze, die Lisa abseits ihrer Fürsorge für Sven über sich ergehen lassen muss, bleiben weitgehend uninteressant und altbacken. Ihr Mann (Jens Albinus, Idioten) nämlich ist Direktor an einer elitären Privatschule in der Schweiz und muss nun die schwerwiegende Entscheidung treffen, ob er seinen Vertrag über weitere fünf Jahre verlängert oder – so wie es abgemacht war – zusammen mit Lisa zurück in das von ihr innig geliebte Berlin kehrt, wo die Kinder nicht mit Oligarchenkindern aufwachsen müssen.
Dadurch wirkt der ohnehin in kalte, entsättigte Bilder gehaltene Schwesterlein oftmals leblos, weil es dem Regie- und Autorengespann um Stéphanie Chuat und Véronique Reymond nicht gelingen möchte, die tiefere Bedeutung aus diesen privaten Zwistigkeiten zu ziehen. Spannender ist da schon der Umstand, dass Lars Eidinger hier bis zu einem gewissen Grad eine nabelschauliche Vergegenwärtigung seiner Selbst darbieten kann, wenn er als todkranker Theaterschauspieler alles dafür geben würden, um noch einmal an der Schaubühne den Hamlet, seine Paraderolle, geben darf. Und Schwesterlein lässt es sich natürlich nicht nehmen, Eidinger in einer Szene als dänischen Shakespeare-Prinzen aufspielen zu lassen, um seine Performance daraufhin hin sukzessive feingliedriger, unaufgeregter, nuancierter zu gestalten. Wer glaubt, dass Eidinger nur noch grelle Extreme kennt, wird hier eines Besseren belehrt.
Die wahre Sensation jedoch ist einmal mehr Nina Hoss, die oberflächlich durch einen bisweilen abgeklärten, reservierten Auftritt als brillante Theaterautorin, die das Schreiben aufgegeben hat, irritieren könnte, das (angeblich) standhafte Äußere aber nutzt, um ihr Inneres durch kleine, pointierte Gesten und Blicke unaufhörlich zum Brodeln zu bringen. Nur in einer Szene gönnt sie ihrem Spiel tatsächlich einen emotionalen Ausbruch, dann, wenn die Luft für Lisa und Sven immer dünner wird; wenn sich die Zeit der Gemeinsamkeit unbarmherzig ihrem Ende nähert. Nina Hoss ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass Lars Eidinger – der zweifelsohne ein hervorragender Schauspieler ist – derart subtil strahlen kann. Mag Schwesterlein insgesamt kein großer Film geworden sein, es ist schon befriedigend genug, zwei großen Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen.