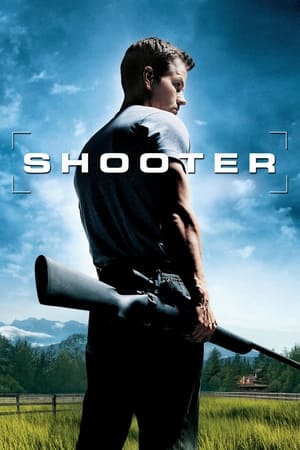Liam Neeson war 56 Jahre alt, als er 2008 mit „96 Hours – Taken“ seinen kommerziell äußerst erfolgreichen Einstieg ins Action-Genre feierte. Der von Pierre Morel inszenierte Reißer, der zuvor mit dem Geheimtipp „Ghettogangz - Die Hölle von Paris“ für erfreute Action-Fans sorgte und die urbane Sportart Parkour ins Genre integrierte, machte aus dem Charakterkopf praktisch über Nacht einen Heroen. Die Auswirkungen: Neeson wird seitdem innerhalb dieser massentauglichen Filmgattungsnische einsortiert und „96 Hours“ erhielt zwei Sequels, wo von keines wirklich überzeugen konnte. Während Neeson also in den Fortsetzungen sowie in anderen Actionfilmen zu sehen war, drehte Morel 2010 „From Paris with Love“, der zwar durch einen prolligen wie glatzköpfigen John Travolta auffiel, jedoch keine nennenswerten Erinnerungen hervorruft. Fünf Jahre danach ist Morel wieder zurück. Wieder mit einem Actionfilm und wieder mit einem Hauptdarsteller, den man mit diesem Genre eher nicht in Verbindung bringt: Sean Penn.
In „ The Gunman“, der Verfilmung eines Romans von Jean-Patrick Manchette, spielt Penn den Söldner Jim Terrier, der Jahre nach einem ausgeführten Anschlag auf einen afrikanischen Politiker ins Visier einer Verschwörung gerät. Wie also auch schon bei „96 Hours – Taken“, heißt es hier Einer gegen Alle. Wobei der Eine natürlich Fähigkeiten besitzt, die ihn zu einem Gegner machen, den niemand unterschätzen sollte. Wer nun aus diesem Konzentrat der Geschichte den Schluss zieht, dass es sich bei „The Gunman“ um einen „Taken“-Epigonen handelt, der irrt sich. „The Gunman“ will mehr Verschwörungs- und Söldner-Thriller sein, als ein Actionfest. Die Momente, in denen es in Morels vierter Regiearbeit kracht und scheppert, sind eher seltener Natur. Dafür sind sie aber stets flüssig und übersichtlich inszeniert. Wilde Stakkato-Schnitte, bei denen man als Zuschauer nicht wirklich realisiert was passiert (Gruß an Neesons Action-Debüt) gibt es hier nicht. Das ist die angenehme Seite von „The Gunman“.
Die negative Seite des Films ist seine Unentschlossenheit. Die gesamte Inszenierung wirkt narrativ-stilistisch relativ wirsch. Sean Penn, der hier nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent und Co-Autor tätig war, wird zwar zu jedweder Zeit in den inszenatorischen Fokus genommen, aber als eine überzeugende Einheit tritt dieser nicht auf. Das Problem ist nämlich, dass der Film die Figur Jim Terrier nie wirklich überzeugend erfasst. Als Held, der dank seiner Fähigkeiten und Erfahrung selbst eine Überzahl von Gegnern niederstreckt, wird er genau so porträtiert wie als gefühlvoller, älter werdender Mann, der eigentlich nur Frieden will und viele Taten aus seiner Vergangenheit bereut. Natürlich, ein Held kann und sollte facettenreich sein, doch bei „The Gunman“ geht dieses Attribut einher mit einer unglaublich anti-homogenen und inkohärenten Inszenierung. Es wirkt fast so, als ob Regisseur Morel den Film in eine Richtung lenkt, während Penn sein Ruder in einen entgegengesetzte Winkel navigiert. Am Ende hatte Penn den längeren Atem, bzw. den größeren Namen und „The Gunman“ nutzt das Adrenalin von Actionszenen nur als Zwischensnack. Das Ganze, diese Diskrepanz zwischen dem Dramaturgen Penn und dem Schauwerteerzeuger Morel erinnert an einen Gag aus der Komödie „Austin Powers in Goldständer“ von 2002. Dort kommt es im Prolog zu einer Szene, in der Held Austin (Mike Myers) dabei ist, wie Regielegende Steven Spielberg einen Film über den Superspion dreht:
Steven Spielberg: „So, Austin, what did you think of the opening credits?”
Austin Powers: „Well, I can't believe Sir Steven Spielberg, the grooviest film maker in the history of cinema, is making a movie about my life. Very Shagadelic, baby, yeah. Having said that, I do have some thoughts.”
Steven Spielberg: [hält seinen Oscar hoch] „Really? Well, my friend here thinks it's fine the way it is.“
So könnte es durchaus auch beim Dreh zu “The Gunman” zugegangen sein. Auf der einen Seite Regisseur Morel, der dem Film konzentrierte wie durchschlagende Action verpassen will, auf der anderen Penn, der als zweifacher Oscar-Gewinner, Co-Produzent und Co-Autor mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am längerem Hebel saß und dem andere Aspekte des Films wichtiger waren.
Nun gut, dramaturgisch ist Penn ja durchaus ein begabter Darsteller wie Filmemacher, nur innerhalb eines, bzw. dieses Action-Films, funktionieren diese Faktoren so gar nicht udn zwar aus dem einfachen Grund, da sie den Film immer wieder bis aufs äußerste Abbremsen. Das Held Jim z.B. eine innere, zerebrale Verletzung hat, die ihn immer wieder dann aus dem Geschehen nimmt, wenn er zu aktiv wird, klingt erstmal wie eine recht nette (wenn auch wenig neue) Idee, die durchaus spannende wie auch dramatische Momente erzeugen kann. Doch sie bringt auch eine unglaubliche Regressivität mit sich, die den gesamten Ablauf des Films immer wieder unschön und auch recht halbherzig ins Stocken bringt. Da hilft es dann auch nicht mehr, dass Morel dem immer kraftloser werdenden Helden am Ende eine eher geistlose, sinnbildliche Parallelmontage spendiert, die Jims verzweifelten Kampf mit dem eines Stieres gegen einen Matador in einer Arena gleichsetzt.
Überhaupt wirkt das Ganze zu oft wie ein Flickwerk. Penn, der seit Jahren ein großes gesellschaftliches Engagement zeigt, scheint viel Wert daraufgelegt zu haben, dass „The Gunman“ vor allem die menschenunwürdigen wie gefährlichen Umstände innerhalb der Krisengebiete Afrikas aufzeigt werden. Feine Sache, aber für den Film selbst höchst kontraproduktiv. Auch weil es der Figur des Jim Terrier - sowie Penn selbst – den miefigen Geruch eines freudlosen Oberlehrers anheftet. Wobei Penn dies wohl durchaus genießt so im Spotlight zu stehen, wie er es am besten hält und liebsten hat. Dagegen verkommt der restliche Cast entweder zu Staffagen oder Witzfiguren. Javier Bardem z.B. liefert hier eine seiner wirklich schlechtesten Leistungen ab und die italienische Darstellerin Jasmine Trinca („Yves Saint Laurent“) bleibt innerhalb ihrer Rolle als typische Damsel-in-Distress festzementiert und profillos.
 Trailer
Trailer