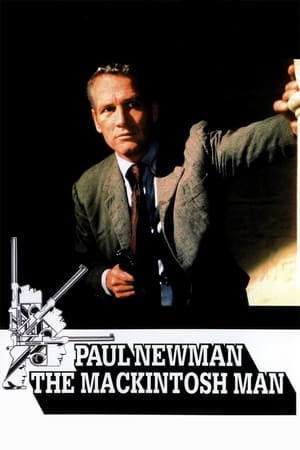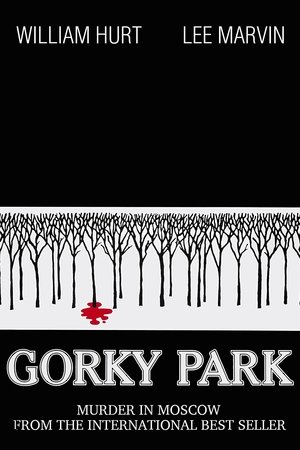Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- 116 Min ActionDramaKrimiThriller USA
- Regie John Huston
- Drehbuch John Huston
- Cast
Inhalt
×