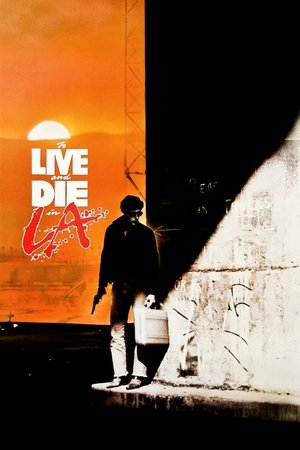Ein Film, der zuletzt derart deutlich wie William Friedkins „Leben und Sterben in LA“ nach den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts schrie, hörte auf den Namen „Kung Fury“ und beinhaltete David Hasselhoff, einen Dino, Thor, coole Autos, Hitler und natürlich eine Boombox. Nun handelte es sich bei dem Kung Fu-Actionflick selbstredend um eine Hommage in Form eines Kurzfilmes an die besagten legendären Jahre, als FCKW-Gase das Klima ordentlich in die Knie drückten und bei Friedkins Film um ein Relikt aus jenen Zeiten. Und dennoch ist es bemerkenswert, wie ähnlich die grelle Schrift im Vorspann leuchtet, wie sehr die Synthies aus allen Kanälen dröhnen und wie veraltet die Schergen hier ebenso wie in "Kung Fury" gezeichnet werden.
Keine Frage, „Leben und Sterben in LA“ sieht man seinen Enrstehungszeitpunkt an. Man kann förmlich drüberhauchen und die Staubschicht lüften, ganz vertreiben lässt sie sich aber nicht. Und dennoch zeugt der Film, der fünf Jahre nach dem skandalösen „Cruising“ in Friedkins Filmographie auftaucht, von einer inhaltlich zeitlosen Dimension. Es handelt sich hierbei nämlich um die guten alten Filme, die sich wohl nur mit den Attributen gut und alt beschreiben lassen. Ein Polizei-Krimi, in dem der Tod eines Partners aufgeklärt werden soll, wobei sich der junge, attraktive, selbstherrliche und überambitionierte Cop Richard Chance (William L. Petersen, „Die 12 Geschworenen“) nicht nur mit den falschen anzulegen scheint, sondern auch das Gesetz aus der Hand legt, die rechtliche und moralische Linie übertritt und sich auf der Suche nach Rache und Gerechtigkeit verirrt.
„Wieso leben wir eigentlich noch hier“ singt der Sänger im Titelsong, der den gleichen Namen wie der Film trägt. Los Angeles, die Stadt der Engel, die Stadt des Glanzes, der Attraktivität, der Popkultur. Selten erschien der Spitzname der Metropole derart zynisch behaftet wie hier. Richard und sein da noch quitschlebendiger Partner Jim Hart (Michael Greene, „Less Than Zero") sind in einem sehr teuren Hotel und sorgen für die Sicherheit eines politischen Tieres. Kurz darauf werden sie Zeuge eines Selbstmordattentates. Ein Mann sprengt sich in die Luft - direkt vor ihnen. Kurz darauf wollen sie in eine ruhigere Abteilung versetzt werden und sollen fortan illegale Geldwäsche aufdecken. Da bekommen sie es aber mit dem erbarmungslosen Eric Masters (Willem Dafoe, „Grand Budapest Hotel“) zu tun.
Die Stadt der Engel, sie ist dunkel und zu heiß geworden. Die Sonne ist weg, aber die Luft hat noch 40 Grad. Die schwüle Hitze drückt auf das Gemüt, nimmt einem die Lust am Wachsein und die Fähigkeit, einigermaßen klare Gedanken zu fassen. Man dampft, man wird zersetzt, Stück für Stück, Atom für Atom. Man vergammelt von innen heraus. Die Engel, die irgendwann angeblich mal über der Stadt wachten, sie haben nichts gegen die Entwicklung tun können. Die Metropole ist zu einem Vorort der Hölle geworden, in dem der Asphalt dampft und der Sand von Schlangen gesäumt ist. Die Engel, sie wirken, als hätten sie aufgegeben. Nicht traurig oder enttäuscht schauen sie auf das Werk herab, sondern übermüdet. Energie und Geduld haben sie vor langer Zeit verloren. California dreamin’.
William Friedkin („Die Stunde des Jägers“) nutzt dieses große Setting, um das Monster des Menschen zu entblößen. Er schickt den Protagonisten Richard in eine Welt, in der es nicht einmal mehr wirklich Grauzonen zu geben scheint, sondern nur den Unterschied zwischen wund- und blutrot. Entweder man verbrennt sich, oder man geht drauf. Der Ort ist oft in dunkelrotes glutheißes Licht getaucht, das jeglichen Lebens- und Moralsaft verdorren lässt. In den tiefsten Gebäuden der reichen aber moralisch verdreckten Menschen finden wir uns hier wieder, wo die Häuser keine Fenster, aber allerlei Waffen vorweisen können und nicht einmal mehr der Regen den Dreck wegwaschen kann. Nur das Blut. In diesen Unterkünften hat die Außenwelt, haben das Recht, das Gesetz und das Richtige keinerlei Wert und keinerlei Kombinationsmöglichkeit. Man muss sich entscheiden, Gesetz oder Vorteil? Eine leichte Entscheidung.
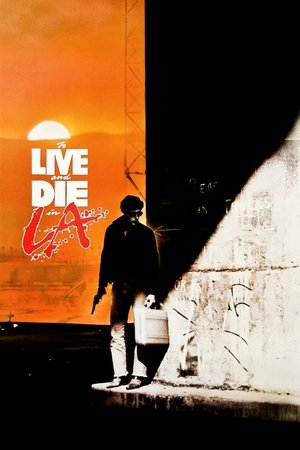 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org