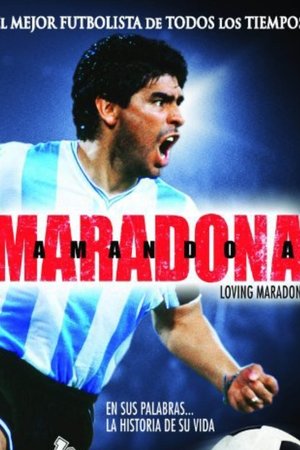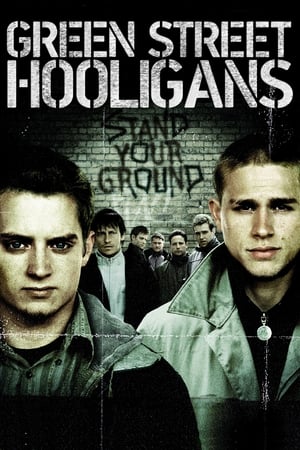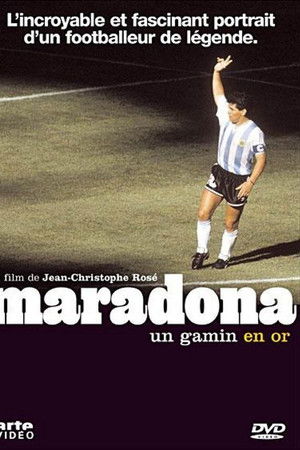Quelle: themoviedb.org
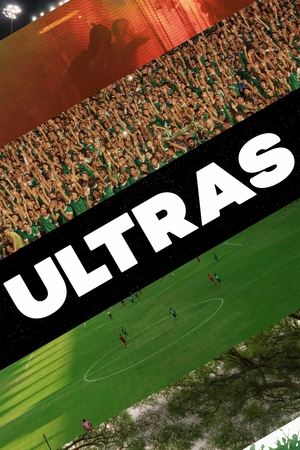
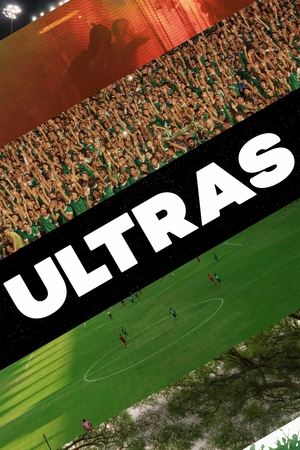
- 89 Min Dokumentarfilm
- Regie Ragnhild Ekner
- Drehbuch Ragnhild Ekner
- Cast
Inhalt
×