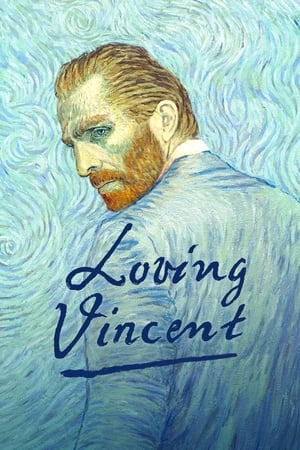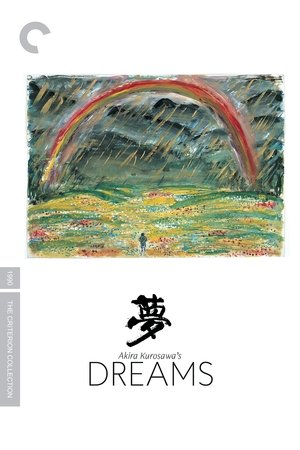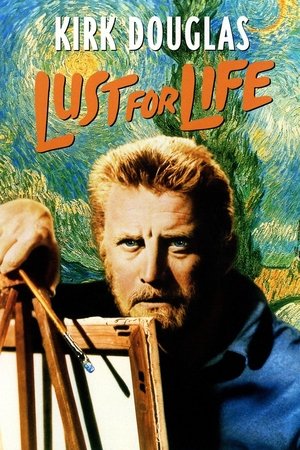„Vielleicht bin ich ein Maler für Menschen, die noch nicht geboren sind.“
Wenn Vincent van Gogh (Willem Dafoe, The Florida Project) im Angesicht der südfranzösischen Landschaftskulisse von Arles nahezu in sich erstarrt, dann kann man von seinen aufblitzenden Augen förmlich ablesen, dass der Künstler hier nicht einfach nur der Schönheit der Natur frönt, sondern in einem fast schon hypnotischen Zustand hinter die Blumenwiesen, die Baumreihen, die sanften Hänge und breiten Talsohlen schaut. Sein Blick dringt tiefer, schneidet sich durch das Materielle, transzendiert es und stößt auf Wahrheit, ja, auf Ewigkeit. Der neuen Film von Julian Schnabel (Schmetterling und Tauscherglocke) trägt im Original nicht umsonst den Titel At Eternity's Gate: Natürlich bezieht man sich damit auf das gleichnamige Ölgemälde von Van Gogh, vielmehr noch aber folgt man hier einer zerrissenen Seele auf ihrem Weg in die Unendlichkeit.
Bezeichnend erscheint der Umstand, dass die Kunst von Van Gogh zu Lebzeiten seiner Person kaum Anklang finden konnte. Sie wurde verschmäht, als verängstigend und grobschlächtig bezeichnet. Julian Schnabel siedelt seinen Film folgerichtig im Jahre 1888 an, zwei Jahre bevor Van Gogh im Alter von 37 Jahre unter bis heute mysteriösen Bedingungen den Tod gefunden hat. Es ist seine produktivste Schaffensphase, in 80 Tage fertigte Van Gogh 75 Gemälde an. Für wenige Woche wusste er den Maler Paul Gauguin (Oscar Isaac, Auslöschung) an seiner Seite, am Ende bliebt ihm nur sein Bruder Theo (Rupert Friend, Nur ein kleiner Gefallen). Der Rest der Welt schien dem Post-Impressionisten feindlich gesonnen. Natürlich auch deswegen, weil seine Kunst ihrer Zeit weit voraus war, aber auch, weil Van Gogh nicht zwei-, sondern drei-, manchmal sogar viergesichtig in Erscheinung trat.
Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit erliegt nicht dem drögen Anspruch, als lexikalische Abarbeitung der wichtigsten Stationen im Leben des Vorreiters der modernen Malerei auf Oscar-Jagd zu gehen; der Film ist kein verfilmter Wikipedia-Artikel. Stattdessen inszeniert Julian Schnabel, selber ein arrivierter Maler, hier eine impressionistische, ungemein eigendynamische Aneinanderreihung von Augenblicken, Gefühlen, Sinneseindrücken und steigt hinab in den zerrütteten Geist eines Mannes, der das Sonnenlicht verehrte, in seinem Inneren aber stetig mit Dunkelheit zu kämpfen hatte. Die behände, schwebende (Hand-)Kamera Benoit Delhomme (Lawless – Die Gesetzlosen) sucht sich dabei ihre ganz eigenen Perspektiven, um auf Van Gogh zu sehen, ihn zu erkunden, abzutasten, anzutreiben – oder seine Sichtweise zu verinnerlichen. Der untere Bildbereich verfällt dabei oftmals in Unschärfen, dieser Van Gogh möchte nur den Himmel, die Wolken, die Sonne kennen.
Im besten Sinne erweist sich Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit als ein inkohärentes, sprunghaftes Erlebnis; er sträubt sich niemals gegen Leerstellen oder Aussparungen und findet dadurch einen ganz eigenen Zugang, um dem Künstler-Porträt im Zentrum über die naturalistischen Bildwelten und den dissonanten Klangteppich auf der Tonspur Kontur und Gravität zu verleihen. Das ständige Oszillieren zwischen Euphorie, Manie, tiefer Traurigkeit und brodelndem Schmerz wird nicht zuletzt durch das gezielt-brüchige und äußerst einnehmende audiovisuelle Erzählen greifbar gemacht. Letzten Endes aber gehört dieser Film dem erneut beeindruckenden Willem Dafoe, der hier fast dreißig Jahre älter ist als der echte Van Gogh. Sein von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht aber bündelt adäquat all das Leid, die Anstrengungen und Entbehrungen, die dieser Mensch über sich ergehen lassen musste, um den Pfad der Ewigkeit für sich zu ebnen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org