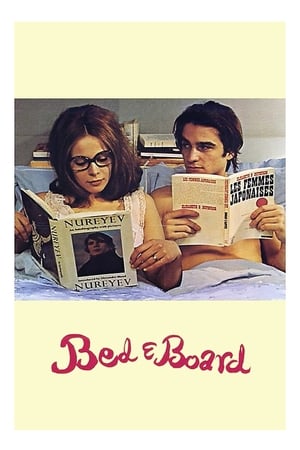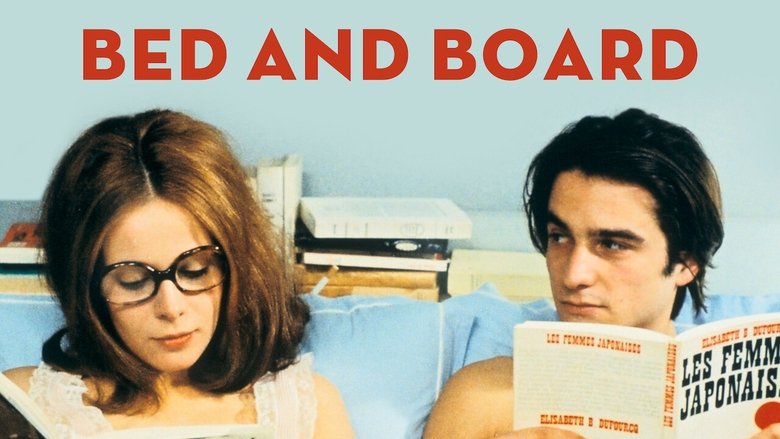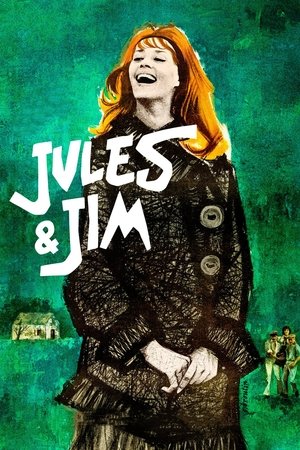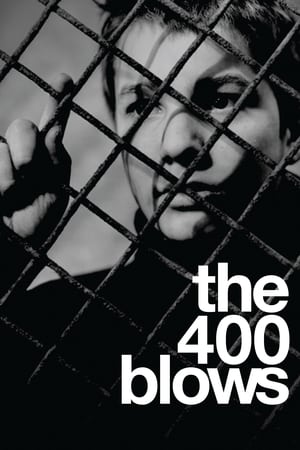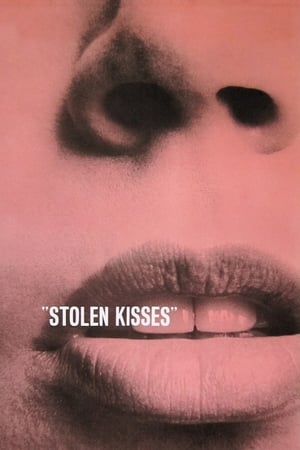„Wenn Du die Kunst benutzt, um Rechnungen zu begleichen, dann ist es keine Kunst mehr.“
Nach der stilprägenden Nouvelle-Vague-PerleSie küssten und sie schlugen ihn, dem federleichten Poem Geraubte Küsse und Antoine und Colette, einer 32-minütigen Episode aus dem internationalen Omnibusfilm Liebe mit zwanzig, ist es nunmehr höchste Zeit, um sich die Frage zu stellen, was Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud, Weekend) nur so faszinierend macht? Francois Truffaut (Schießen Sie auf den Pianisten) würde darauf vielleicht antworten, dass es Antoines gesunde Skepsis in Bezug auf das Konstrukt Gesellschaft ist, mit dem wir, die Zuschauer, uns am ehesten identifizieren können. Im Prinzip aber ist dieses Misstrauen nur eine Facette der Persönlichkeit, die den Antoine-Doinel-Zyklus bestimmt und aufzeigt, dass es letzten Endes eben doch die Summe seines flatterhaften Wesens ist, welches animiert, wieder und wieder Stunden mit dem sprunghaften Freigeist zu verbringen.
Tisch und Bett, die direkte Fortschreibung von Geraubte Küsse, präsentiert uns nun einen Antoine, der tatsächlich auf Tuchfühlung mit einer bürgerlichen Existenz geht: Er hat erfolgreich um die Hand seiner Jugendliebe Christine (Claude Jade, Topas) angehalten, lebt in einer geräumigen Hinterhofwohnung nahe der City und scheint auch mit dem Färben von Blumen eine Beschäftigung gefunden zu haben, die ihm nicht vollständig missfällt. Wie wir Antoine in der Vergangenheit aber bereits kennengelernt haben, sollte schnell klar werden, dass sich sein Gemüt kaum mit dem eines souveränen Zeitgenossen abgeglichen lässt, was es auch folgerichtig zu einem logischen Umstand erklärt, dass Antoine mit seinem – oberflächlich – angepassten Dasein hadert. Und unter diesem Gesichtspunkt formuliert Truffaut ein Anliegen von überzeitlicher Beschaffenheit: Was, wenn wir uns den Idealen der Gesellschaft anpassen wollen, aber grundsätzlich nicht dafür geschaffen sind?
Dieser Aspekt ist selbstverständlich vielfach konnotiert und erstreckt sich über die privaten wie die beruflichen Bereiche: Wie oft darf man scheitern, bis der Punkt erreicht ist, an dem man wirklich aufgeben darf? Antoine allerdings denkt nicht an das Aufgeben, was ihn zum einen zu einer herrlich willfährigen Person erklärt, auf der anderen Seite aber auch aufzeigt, dass die Gleichgültigkeit, mit der Antoine von einer Station zur nächsten stolpert, auf einer selbstverklärenden Egozentrik basiert, die Truffaut nicht verurteilt, aber niemals unkommentiert unter den Tisch fallen lässt. Es bleibt also auch in Tisch und Bett dabei: Antoine würde sich zwar gerne als Bestandteil der Erwachsenenwelt sehen, doch dafür fehlt ihm schlichtweg der gefestigte Stand im Hier und Jetzt, was sich auch an seiner Ehe verdeutlicht, die oft den Anschein erweckt, als würden hier zwei Kinder Vater, Mutter, Kind spielen.
Natürlich aber ist Francois Truffaut kein pessimistischer Filmemacher, der seine Protagonisten in den lebensweltlichen Niedergang geleitet. Bei ihm gibt es immer noch diese warme Decke, die sich voller Geborgenheit um die Schulter legt und den funkelnden Hoffnungsschimmer am Horizont, der aus seiner unbändigen Liebe zur Alltagspoesie entwächst: Letztlich ist es doch genau diese Addition von Scheitern und Begehren, welche kein Leben zerstört, sondern ein solches eben auch ausmacht, formt und für die Zukunft ebenen kann. Entkoppelt von den Mechanismen des klassischen Storytelling verweilt Tisch und Bett dabei vorwiegend auf einer Ebene, die rein affektiv erfahrbar gemacht wird, anstatt sich einem klaren Handlungsmodell zu unterwerfen. Und außerdem ist es, beim chronologischen Genuss des Antoine-Doinel-Zyklus, wunderbar zu beobachten, wie die Schauspieler mit ihren Charakteren von Film zu Film wachsen, reifen und gedeihen.
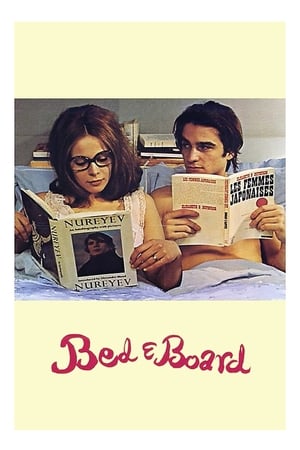 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org