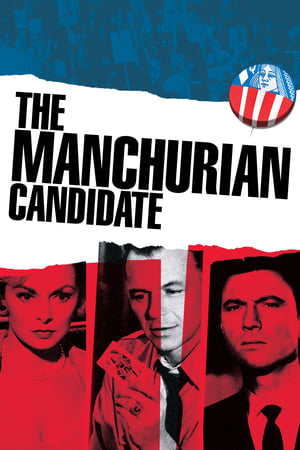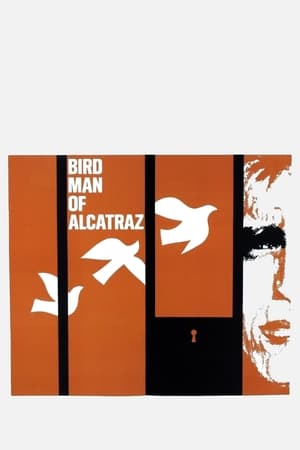Wovor fürchtete sich der durchschnittlich-paranoide Ami in den 50ern am meisten? Primär bestimmt vor einem atomaren Krieg, doch eine noch größere Furcht herrschte vor der Infiltration der inneren Sicherheit. Der möglichen Unterwanderung der eigenen Gesellschaft, der subversiven Zerstörung der freien Demokratie und den unanfechtbaren, sauberen Werten durch den Klassenfeind, die von der Politik – allen voran Senator Joseph McCarthy – gezielt geschürt wurde. Idealer Nährboden für Verschwörungstheorien, moderne Hexenjagden und natürlich auch aus heutiger Sicht fast surreal wirkender Bedrohungsszenarien. Mal real, mal rein fiktiv, oft eine Mischung aus beidem.
Botschafter der Angst bzw. The Manchurian Candidate (2004 unter gleichem Namen neuverfilmt, inhaltlich nah dran und hauptsächlich nur in zeitbedingten Details abgeändert) arbeitete diese Zeit 1962 in eben so einem Stil auf. Zwischen theoretisch denkbaren Worst-Case-Motiven und fast absurder Spinnerei, dass in seiner Extreme noch fiktiv genug ist und dennoch die Hysterie dieser Tage exakt an ihrem Nerv trifft. Mit noch nicht allzu beruhigendem Abstand. Der Kalte Krieg hatte sich noch lange nicht besänftigt, ganz im Gegenteil, nur die Panik vor internen Attacken wurde nicht mehr in dieser ausufernden Form von einem polemischen Kreuzzug gegen das angeblich existente Böse in den eigenen Reihen geprägt. Das angespannte, alles überschattende Thema dieses Zeitraums benutzt John Frankenheimer (Ronin) bei seiner Buchadaption geschickt als Trigger, um seinen zweiten, großen Erfolg nach Der Gefangene von Alcatraz einzufahren. (Damals) Noch aktuell, aber nicht zu brisant und auf seine durchaus sarkastisch implizierte Weise eine kleine Form der Abrechnung mit der McCarthy-Ära, verpackt in einen manchmal (besonders gen Ende) packenden Spannungsfilm, der auf den Weg dahin leider oftmals ungelenke Purzellbäume schlägt, einen gelegentlich etwas irritiert und unfreiwillig belustigt bzw. verwundert im Regen stehen lässt.
Einem guten Stück Suspense-Qualität wird sich schnell selbst beraubt, da kein großes Geheimnis um das Geschehen an der Front gemacht wird. Als Zuschauer ist man sehr schnell im Bilde und damit seinen Hauptfiguren Major Maco (Frank Sinatra, Frankie und seine Spießgesellen) und dem bemitleidenswerten, umprogrammierten (und doch immer schon manipulierten) Shaw (Laurence Harvey, Alamo) meilenweit voraus. Ein leichter Wissensvorsprung ist gar nicht mal schlimm, da der Plot diesen ein Stück weit benötigt, was man jedoch etwas langsamer einschmelzen lassen könnte. Unabhängig davon verläuft bei Botschafter der Angst nicht alles auf hohem Niveau, was schon bei Frank Sinatra anfängt. Eine starke Type, ein Charisma-Bolzen, ein durchschnittlicher Darsteller, der gelegentlich hier schon an seine Grenzen stößt. Alles noch verkraftbar, aber der Rolle könnten andere mehr Wirkung entlocken. Der deutlichste Knackpunkt liegt allerdings in dem unnötigen und besonders kuriosen Wechselspiel von Skript und Inszenierung, die sich ab und zu ein merkwürdiges Ei ins Nest legen.
Einige Dialoge wirken arg gestelzt, fast albern sinnentleert aufgebläht und manche Szenen entbehren nicht einer gewissen Form von Galgenhumor. Highlights: Die schäbige, erschreckend mies vorgetragene „Martial-Arts-Szene“ zwischen Frankie und Henry Silva (Megaforce; als Asiate natürlich prima und ganz Klischee-befreit besetzt), die an Slapstick grenzt oder eine schrullige Rückblende mit Laurence Harvey, die einer Parodie gleichkommt. Ohnehin werden Romanzen hier sehr schnell zum heiratsfähigen Paket geschnürt, über die Rolle von Janet Leigh (Psycho) kann man generell nur den Kopf schütteln. Klingt übel, aber Botschafter der Angst driftete so eher in den Bereich des unfreiwilligen Edel-Trashs ab. Zwischen Big-Budget-Pulp und doch noch effektivem Thriller, gerade da ihm ein satirischer und bissiger Subtext jederzeit anzumerken ist. Was hier manche Passagen und die großen Stars drohen zu vergeigen, rettet mit nicht geringem Anteil die fantastische Angela Lansbury (Tod auf dem Nil), die man in dem Part des Welpen-fressenden Muttertiers selten diabolischer, eiskalter und präsenter gesehen hat. Und wenn der Film seine Stärken, seinen reflektierten und zynischen Unterton in der Vordergrund schiebt, kann man ihm kaum seine Klasse aberkennen. Wie man kaum leugnen kann, dass er diese nicht konstant verwirklichen kann.
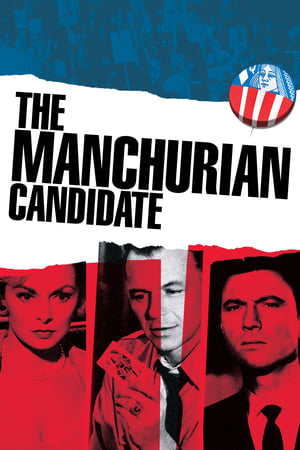 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org