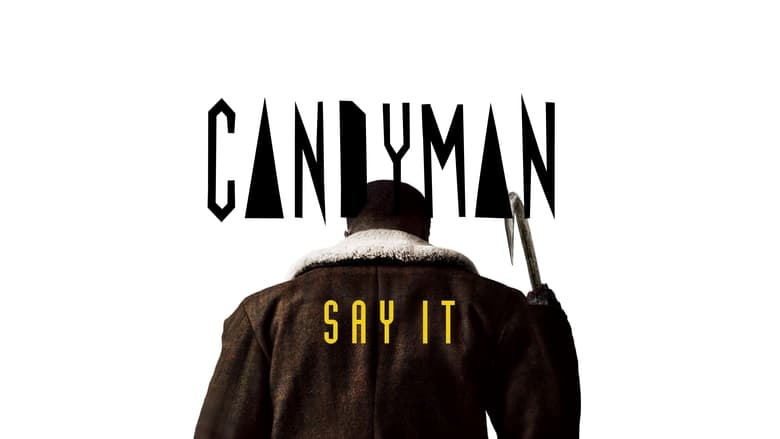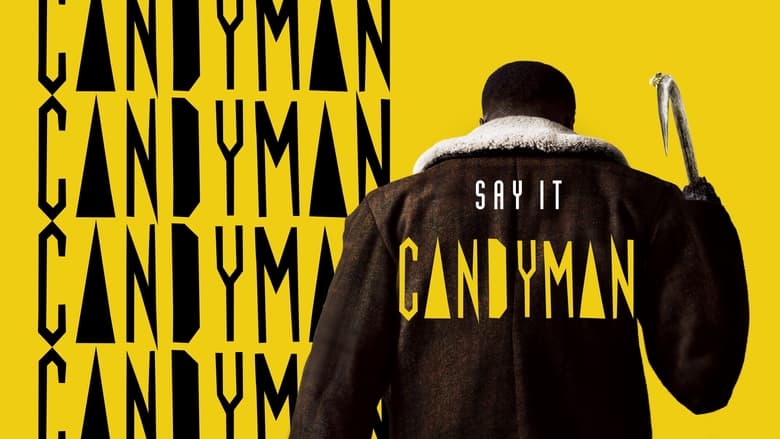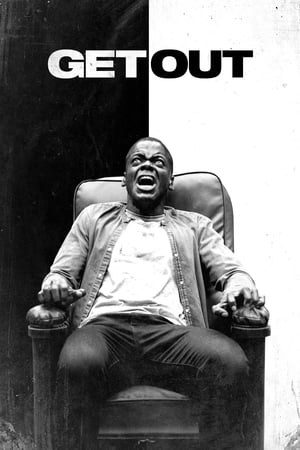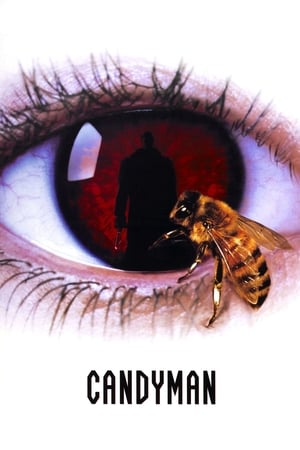„Say his name. I dare you“
1992 war Bernard Rose mit seinem Candyman seiner Zeit ein bisschen voraus, denn großes Metapher-Horrorkino über soziale Missstände wurde erst in den späten 2010ern so richtig gefragt. In seiner Vision ist der von Tony Todd (Final Destination) gespielte Candyman eine urbane Legende, ein Monster, das sich an der Wiederholung seiner schaurigen Geschichte nährt. Sag seinen Namen fünfmal vor dem Spiegel und er kommt, um dich zu holen. Candyman ist das Flüstern in den Klassenzimmern, die Mutprobe im Badezimmer. Ein Geist der Vergangenheit, begleitet mit einer Hakenhand und einer Armee von Bienen, geboren durch das verdrängte Trauma von allem, was eine Gesellschaft von sich abstoßen will: Der schmerzhafte Rassismus, die soziale Ungleichheit und, in Roses Film explizit, die Gentrifizierung, welche die Nachbarschaft des Candyman, Cabrini Green, ihre Identität gestohlen hat. Doch Geister lassen sich nicht vertreiben, denn der Schmerz, der sie erschuf, lebt für immer. Es ist deswegen nur logisch, dass eine neue Interpretation der Geschichte folgen musste, um die Legende am Leben zu halten. Nia DaCosta (Little Woods) nahm sich in Zusammenarbeit mit Jordan Peele (Get Out) diese neue Kreation des Mythos an und weiß dieser zumindest ästhetisch einiges hinzuzufügen.
Da Costas Candyman beginnt als Invertierung des Originalfilmes: Während in Roses Film wir zu Beginn auf die in die Identitätslosigkeit gentrifizierte Nachbarschaft von einer schwindelerregenden Vogelperspektive herabblicken, so dreht sich dies in DaCostas Film. Nun blicken wir von unten auf die modernen Wolkenkratzer herauf und erleben deren alles überblickende Ungetümer aus Beton und Stahl. DaCosta markiert hiermit, dass sie genau da weiter macht, wo Rose aufhörte: Sie will der, sich in ihrer aufgeklärten, abgesicherten Oberschicht, die sich diesen Ort bemächtigt hat, den blutigen Spiegel vorhalten und zeigt dabei mindestens genauso wenig Sympathie für jene Menschen, die glauben, von allen Geistern der Vergangenheit sicher zu sein. Der Künstler Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II, Wir) ist es schließlich, der den Mythos wieder heraufbeschwört. Angetrieben von dem Versuch, die Gentrifizierung von Cabrini Green künstlerisch-visuell aufzuarbeiten, verbreitet er die Legende erneut, unwissend gegenüber den Mächten, die er entfesselt. Diese Wahl der Prämisse und auch des Milieus aus arroganten, selbstbesoffenen Künstlerinnen, die den Schmerz, den sie als Vorlage für ihre Kunstwerke benutzen, niemals verstehen werden, wirkt zunächst passend, da der Film sich auf diese Weise im Grunde selbst verhandelt: Was ist DaCostas Neuinterpretation anderes, als nicht ein weiterer Versuch, ein Trauma zu begreifen, was schlichtweg rational niemals begreifbar sein kann? Im Gegensatz zu Roses Film legt sie den Finger noch aggressiver in die Wunde, agiert dabei aber auch deutlich unsubtiler und scheint alle Wege zu gehen, die Metapher auch verständlich zu machen. Irgendwann sagt die Kunstkritikerin Finley Stephens (Rebecca Spence, Contagion) McCoy sogar explizit, dass es KünstlerInnen wie er sind, die sich diesen Mythos eher einverleiben wollen, als wirklich an deren Aufarbeitung interessiert zu sein. DaCostas Film kann man beides vorwerfen: Zum einen bemüht sich ihr Film, die Geschichte des Candyman für eine neue Ära, welche aber immer noch von Rassismus und Ausbeutung infiziert ist, zu aktualisieren, gleichzeitig bleibt aber die Frage zurück, was DaCosta dieser Geschichte wirklich noch hinzufügen kann.
Dies fängt schon bei der Grundthematik um die, im Zentrum stehende, Gentrifizierung des Nachbarortes an: Während in Roses Film die enteigneten Bewohner, die in dieser modernisierten Welt keinen Platz mehr finden, noch Personen sind, also, Gesichter und Stimmen haben, existieren sie in DaCostas Film überhaupt nicht mehr. Die Slums von Cabrini Green, durch die McCoy wandert, sind nun menschenleer. Nur noch der Waschsalonbesitzer William Burke (Colman Domingo, Lincoln) streift durch die leeren Häuser und weist McCoy schließlich in die Legende ein. Das Fehlen der Präsenz der Enteigneten kann man zwar als Kommentar auf deren Verschwinden sehen, dem Film thematisch etwas hinzufügen tut es jedoch wenig. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass der Film dieses Thema irgendwann komplett aus den Augen verliert, um sich auf eine viel reißerische Problematik zu konzentrieren: Rassismus und Polizeigewalt. Was im Angesicht aktueller sozialer Unruhen zwar gut gemeint ist verkommt im weiteren Verlauf des Filmes aber immer mehr zum Zeigen auf das leicht Verständliche. Als alleinstehender Film würde DaCostas Candyman vielleicht hier überzeugen. Da der Film aber, genau wie Protagonist McCoy, den Wagemut begeht, sich in die Tradition einer alten Geschichte einzureihen, stellt man nur fest das Roses Film 1992 schon deutlich weiter war. Während Roses Candyman ein expliziter Horrorfilm war, der sich stärker auf abstrakte Andeutungen fokussierte und dem Publikum weitere Interpretationen überließ, ohne aber die soziale Thematik zu verwässern, so interpretiert Candyman 2021 sich schon selbst und begreift sich zu stark als Film mit wichtiger Botschaft. Viel mehr überzeugen kann der Film in den Momenten, in denen der Candyman zuschlägt, in den Momenten, in denen McCoy vor dem Spiegel steht um dem Monster, das er beschworen hat und das im Begriff ist, sich ihn einzuverleiben, in die Augen zu sehen. DaCosta rahmt all dies in ästhetisch ansprechende Bilder, die irgendwann so unheimlich wirken, dass man meint, Candyman in jeder Einstellung im Hintergrund erspähen zu können. Es sind genau diese Augenblicke, in denen der Film uns den Schrecken, den wir vergessen haben und an dem wir Mitschuld sind, sich vor uns vergegenwärtigt. Die Kamera von John Guleserian (Alles eine Frage der Zeit) zeigt sich, genau wie DaCostas Inszenierung, fasziniert von dieser Kreatur, deren Schrecken man niemals in Worte fassen kann, sodass man sich wünscht, das Drehbuch hätte diesen Aspekt auch verstanden.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org