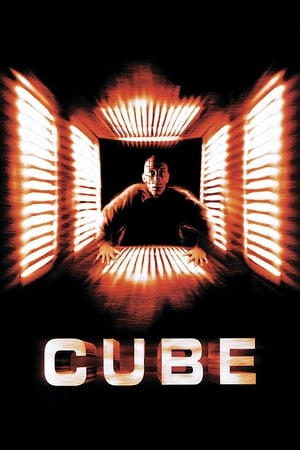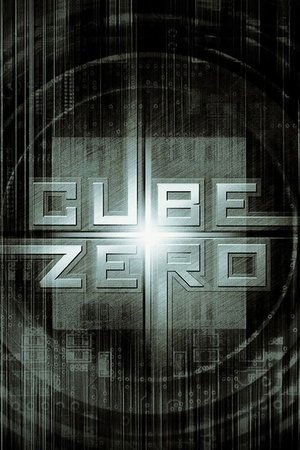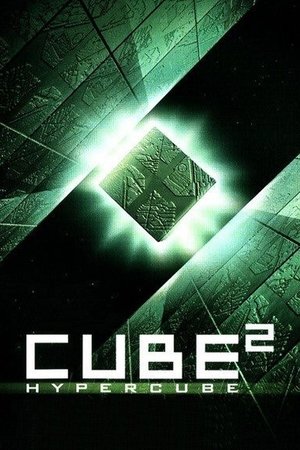Im Zuge des aktuellen Stephen-King Hypes erschien unlängst die Verfilmung der Novelle Im hohen Gras beim Streaminganbieter Netflix. Und schon allein aufgrund des Szenarios, in welchem sich die handelnden Akteure dort inmitten eines gigantischen Grasmeers wiederfanden, weckte der Mysterythriller Erinnerungen an das Werk, bei welchem der Kanadier Vincenzo Natali (Splice) erstmalig sein Regiezepter schwang und damit umgehend für internationales Aufsehen sorgte. Damals feierte sein Debüt Cube unter anderem auf dem Sitges Filmfestival, das ironischerweise gerade ebenfalls aktuell im Gange ist, Premiere. Dort konnte der für lachhafte 365.000 kanadische Dollar realisierte Mysteryhorrorstreifen nicht nur den Preis für den Besten Film, sondern auch das beste Originaldrehbuch einheimsen, auch wenn er sich Letzteres mit Gaspar Noés Menschenfeind teilen musste.
Aber selbst 20 Jahre und eine obligatorische Fortsetzung (Cube 2: Hypercube) sowie ein Prequel (Cube: Zero) später, hat Cube kaum etwas von der Faszination seiner ebenso simplen wie genialen Grundidee verloren. Und insbesondere aus heutiger Sicht ist es nicht nur bemerkenswert, wie vergleichsweise wenig der Zahn der Zeit an den denkbar kostengünstigen Produktion genagt hat, sondern auch, wie der Film sich selbst jetzt noch mit Leichtigkeit gegen weichgespülte Teenie-Varianten wie Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth behaupten kann. Seine immense Sogwirkung entwickeln kann Cube dabei bereits innerhalb der ersten Minuten. Das sterile, unwirkliche Setting nimmt einen hier ebenso unmittelbar gefangen wie den allerersten, wortlosen Probanden, den Vincenzo Natali und seine Co-Autoren André Bijelic und Graeme Manson (Snowpiercer) durch ihr riesiges Rattenlabyrinth jagen. Mit einem wahrhaft heftigen Schlag in die Magengrube des Zuschauers machen sie die Regeln ihres perfiden Spiels unmissverständlich klar, ehe dieses richtig eröffnet wird.
Ebenso wie die, zunächst allem Anschein nach, willkürlich zusammengewürfelte Gruppe von Menschen, wirft der Film einen so unvermittelt in diesen klaustrophischen Albtraum hinein, dass man gar nicht mal unbedingt großartige Sympathien für die eher schematisch gezeichneten Figuren aufbringen muss, um mit ihnen von Minute Eins an mitzufiebern. Genretypisch liefert Cube mit seinen sechs Protagonisten, die hier allesamt nach großen Staatsgefängnissen und Haftanstalten benannt sind, natürlich keine komplexen Charakterporträts ab. Viel eher fungieren sie als bloße Funktionsträger, die sich im Verlauf fast schon unheimlich in ihren jeweiligen Eigenschaften und Fähigkeiten zu ergänzen scheinen. Da hätten wir den charismatischen Cop Quentin (Maurice Dean Wint), die schüchterne Studentin Leaven (Nicole de Boer), die paranoide Psychologin Holloway (Nicky Guadagni), den Zyniker Worth (David Hewlett), den gealterten Überlebenskünstler Rennes (Wayne Robson) sowie den Austisten Kazan (Andrew Miller).
Alle sind sie klar definiert in ihrem Verhalten, alle haben sie mehr oder weniger, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, ihren Ovolos zum großen Ganzen beizusteuern. Dem Drehbuch gelingt es aber dennoch, jeden von ihnen zumindest rudimentär charakterlich zu umreißen und auch durchaus einige unerwartete Wendungen aufzubieten. Zudem sieht man sich als Zuschauer ständig damit konfrontiert, die anfangs noch so klar verteilten Sympathien ebenso oft hin- und hergeschoben und erschüttert zu sehen wie der gigantischen Würfelkomplex selbst. Schauspielerisch bewegt man sich hierbei auf einem grundsoliden Niveau, auch wenn keiner der damals überwiegend unbekannten Darsteller so richtig glänzen kann. Insbesondere Maurice Dean Wint trägt als Quentin im letzten Drittel doch merklich zu dick auf und gleitet mit dem gleißenden Weiß in seinen weit aufgerissenen Augen auch schon mal ins unfreiwillig komische Overacting ab.
Obwohl der titelgebende Kubus nicht, wie im Film behauptet, aus über 17.000 identischen Räumen bestand, sondern aus lediglich einem auf einer 5x5x5 Fuß messenden Tribüne in Toronto, gelingt es Cube, dies gekonnt zu kaschieren. In die Wände integrierte Platten mit wechselnden Farben (Rot als Warnsignal) und geschickte Kamerawinkel sind alles, was Vincenzo Natali braucht, um trotz einiger, studentenfilmtypischer Anschlussfehler, stets Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Die zunehmende Entfremdung von der Realität entsteht bei Figuren wie Zuschauerschaft auch dadurch, dass sich die reale Welt um den Kubus herum sogar noch abstrakter und formloser gestaltet als dessen Innenleben. Irgendwann scheint man selbst ausreichend zermürbt und gewillt, sich dieser gnadenlos durchrationalisierten Kubikmeter-Hölle zu ergeben und sie als neue Wirklichkeit anzunehmen. Dieses Kontrastverhältnis von Substanz und Leere, greift der Film aber auch anderweitig auf. Neben der altbekannten Erkenntnis, dass solche Extremsituationen für gewöhnlich früher oder später das Schlechte im Menschen hervorbringen, steht eine ganze Kette von W-Fragen die ganze Zeit über buchstäblich mit im Raum: Was ist der Cube? Wozu ist er da? Wer hat ihn gebaut? Wo befindet er sich? Und, womöglich am allerwichtigsten: Wie entkommt man ihm?
Vincenzo Natali spielt fortwährend gewitzt mit seinem Publikum und manchmal scheint es fast, als würde er einem dabei einen dieser berühmt-berüchtigten Rubix Cube Zauberwürfel stets feixend vor die Nase halten. Aber ebenso wie deren Sinn und Zweck, sollte man dessen überdimensional großen Bruder am besten gar nicht erst hinterfragen, sondern schlicht nach einer Lösung dafür suchen. Natürlich kann man sich auf die Verschwörungstheorien der Psychologin Holloway einlassen oder den trotzigen Pessimismus von Zyniker Worth, greifen werden letztlich aber bloß die gnadenlos logischen, mathematischen Prinzipien, die die nickelbebrillte Leaven altklug von sich geben darf. Obwohl viele Zuschauer sich schon bei Primzahlen unangenehm an die eigene Schulzeit erinnert fühlen und die wenigsten bei den umhergeschmissenen Fachtermini von karthesischen Koordinaten bis hin zu Permutationen wirklich durchsteigen dürften, so ist dies letzten Endes Mittel zum Zweck. Anders als in Darren Aronofskys Debütfilm Pi, welcher die namensgebende Zahlenabfolge ebenfalls mit Paranoia und Obsession verknüpfte, ist Mathematik hier kein vorherrschendes Prinzip und trotz konsequenter Geschlossenheit eher näher am üblichen Technogebrabbel vieler Sci-Fi Filme anzusiedeln (ironischerweise gehörte Darstellerin Nicole De Boer damals zur Stammbesetzung von Star Trek: Deep Space Nine).
Cube ist ganz sicher kein Film für absolute Logikfetischisten und gerade diese dürften doch merklich enttäuscht sein, wenn der Film zwischen all der arithmetischen Zahlenschieberei und wilden Spekulationen keinen obligatorischen Schlusstwist, geschweige denn eindeutige Antworten parat hält. Zweifellos ist das Mysterium um den Cube, dem zwar im Verlauf immer wieder Puzzleteile hinzufügt werden, die aber nie ein Gesamtbild formen, etwas, über das man sich hier zweifelsohne den Kopf zermartern kann, über dessen Sinn und Unsinn sich hier gewiss ebenso vortrefflich streiten ließe wie über den des gesamten Films. Umgekehrt kann man sich das aber auch völlig sparen, Cube als reinrassigen Indie-Genrefilm begreifen und genießen, der damals wohl eine Folge The Twilight Zone und heute eine besonders kuriose Folge der Netflix-Dystopie Black Mirror abgeben würde.
Klar gegen eine solche Massentauglichkeit sprechen da allerdings die unerwartet heftigen Gore-Anteile. Die Fallen, die Natali und seine Co-Autoren hier ausgetüftelt haben, sind, auch nach der indirekten Epigone in Form der Saw-Reihe, selbst nach heutigen Maßstäben nicht von schlechten Eltern. Besonders nervenaufreibend: ein Raum, dessen in den Wänden versteckte Klingen per Klang und Schall aktiviert werden und den es daher nahezu komplett lautlos zu durchqueren gilt. Dabei sieht man den herrlich fiesen Splattereinlagen kaum ihr Alter oder die begrenzten Möglichkeiten an. Wie auch dem gesamten Film, welcher sich im Laufe der Jahre schließlich nicht von ungefähr längst zum Kultobjekt entwickelt hat.
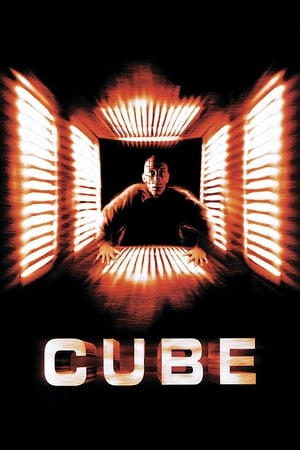 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org