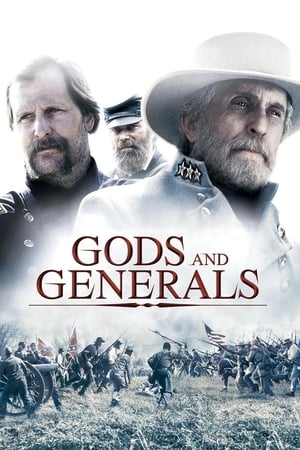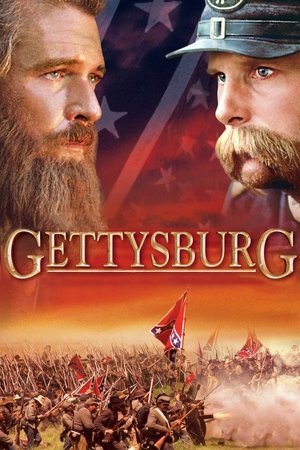Kriegsfilme sind und waren im US-Kino seit jeher gang und gäbe, erstaunlicherweise gibt es aber ausgerechnet über DEN US-amerikanischsten Krieg überhaupt verhältnismäßig wenige Filmadaptionen, zumindest für die ganz große Leinwand. Während man über den Zweiten Weltkrieg oder den Vietnamkonflikt mühelos etliche Filme aus dem Stehgreif aufzählen könnte, sieht das bei Beiträgen über den von 1861 und 1865 andauernden Sezessionskrieg anders aus. Der Krieg zwischen den aus den Vereinigten Staaten ausgetretenen Konföderierten aus dem Süden und den verbliebenen Unionsstaaten aus dem Norden wurde überwiegend im TV-Bereich immer mal wieder ausgewertet, als Kinostoff tat man sich diesbezüglich immer wieder sehr schwer. Ob man das Thema für den internationalen Markt als „zu amerikanisch“ betrachtete ist dabei eher unwahrscheinlich, schließlich sieht man im US-Kino naturgemäß selten über den eigenen Tellerrand hinaus. Vielmehr liegt der Gedanke nahe, dass man sich mit dem Aufarbeiten der eigenen, wenig rühmlichen Vergangenheit immer noch sehr schwertut, zumindest außerhalb der eigenen TV-Landschaft. Und wenn, waren diese seltenen Versuche nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. 1985 scheiterte ein Revolution sowohl an den Kassen als auch bei der Kritik derartig (und absolut verdient) krachend, dass sich dessen Star Al Pacino danach für vier Jahre gar gänzlich aus dem Filmgeschäft zurückzog und lieber wieder konstant am Theater spielte (sicherlich nicht ausschließlich, aber zumindest zum Teil auch deswegen).
Mit Glory unternahm man 1989 noch mal einen Versuch, das Thema ganz groß im Kino aufzuziehen. Thematisiert wird dabei die 54. Massachusetts Infanterie unter der Führung von Colonel Robert Gould Shaw (Matthew Broderick, Godzilla), dem mit gerade einmal 25 Jahren die Führung über eine ausschließlich aus afroamerikanischen Soldaten bestehenden Einheit übertragen wird. Ein schwieriges Unterfangen, da die Männer nicht nur über keinerlei militärische Erfahrung verfügen, sondern auch in den eigenen Reihen kaum akzeptiert werden und mit allerlei Diskriminierung und Vorurteilen konfrontiert werden. Auch Shaw muss sich selbst und seine Methoden zwischenzeitlich immer wieder hinterfragen und feststellen, dass seine Männer auch innerhalb der Union alles andere als gleichberechtigt behandelt werden. Der Film stützt sich dabei auf Tatsachen, zumindest in den Eckdaten. Sowohl die 54. Massachusetts Infanterie sowie Robert Gould Shaw hat es wirklich gegeben, ebenso die hier gezeigten Schlachten, insbesondere die finale am Fort Wagner in Charleston, die rückblickend als ein kriegsentscheidendes Ereignis angesehen werden muss. Alle anderen Figuren und der dazwischen entwickelte Plot sind hingegen rein fiktiv.
Warum Filme über den amerikanischen Bürgerkrieg scheinbar keine so einfach und oftmals eine ziemlich ambivalente Angelegenheit sind, demonstriert das Werk unter der Regie von Edward Zwick (The Last Samurai) relativ eindeutig. Einerseits scheint man durchaus darum bemüht, sowohl die teils barbarische Grausamkeit und schier unfassbare Sinnlosigkeit eines derart primitiven Schlachtfeld-Getümmels, sowie natürlich ebenfalls die auch auf Seiten der Nordstaaten stattgefundene Diskriminierung der zwar offiziell befreiten, aber längst noch nicht gleichberechtigten Farbigen zu thematisieren, greift dabei aber überwiegend auf oberflächlich-theatralische Mechanismen zurück, die andererseits einen sehr negativ-patriotischen, wenigstens relativierenden bis oftmals schon kriegsbejahenden Tonfall anschlagen. Im Prinzip spielt er auch nur die Klaviatur so vieler US-Kriegs-Heldenreisen von A bis Z durch. Zeigt zwar hier und da die ein oder andere Ungerechtigkeiten und Verfehlungen auf, ordnet diese letztendlich aber dann doch dem großen Ganzen unter und verweist schlussendlich lieber auf den Erfolg und unerschütterliche Tapferkeit, die daraus resultiert. Statt ein wahrhaftiges Bild der damaligen Situation und eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit darzulegen, wird sich lieber in stolzer Legendenbildung und Selbstbeweihräucherung der Tapferkeit gebadet, was wohl als tatsächlich als Respektbekundung aufgefasst werden soll. Das damit in Wahrheit hauptsächlich das eigene, fragwürdige Weltbild von „für die gute Sache stolz in den Tod marschieren“ glorifiziert wird, als sich ernsthaft mit der Situation der genau genommen als Kanonenfutter verheizten, farbigen Soldaten zu beschäftigen, wird mit den üblichen Mitteln bewährt kaschiert.
An der nötigen Bedeutungsschwangerschaft mangelt es dabei natürlich keinesfalls. Von Beginn an hämmert einem James Horner mit seinem ultra-pathetischen Score schon ein, worauf wir uns hier emotional bitte gefälligst einzustellen haben. Ein beliebtes und bewährtes Stilmittel solcher Filme, die sich eher über einstudierte Momente als über ehrlich evozierte Emotionen definieren. Denn wenn wir mal einen genaueren Blick auf das Skript (oder zumindest die hier präsentierte Umsetzung davon) werfen, erweist sich Glory auch eher als eine Aneinanderreihung einzelner Szenen als eine narrativ konsequente Geschichte. Die Charakterentwicklungen und Konflikte sind generisch bis sogar sprunghaft und die Figuren nicht mehr als Spot-Monkeys, die in gewissen Situationen mal einen mehr oder weniger großen Moment präsentieren dürfen. Zumindest machen einige daraus wirklich das Beste, was insbesondere die afro-amerikanischen Darsteller betrifft. Neben Morgan Freeman (The Dark Knight) oder Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine) kann ganz besonders Denzel Washington (The Equalizer) sich dies zunutze machen und bekam für seine beeindruckend impulsive Darstellung den Oscar als Bester Nebendarsteller, was den Grundstein seiner Karriere als A-List Darsteller bedeutete. Bei den Academy Awards war der Film ohnehin relativ erfolgreich: neben dem Goldjungen für Washington gab es noch einen für Bester Ton und Bester Kamera, was dem einstigen HAMMER-Regisseur Freddie Francis (Der Satan mit den langen Wimpern) im stolzen Alter von 72 Jahren seinen zweiten Kamera-Oscar einbrachte – satte 30 Jahre nach Söhne und Liebhaber, damals noch in Schwarz/Weiß.
Technisch lässt sich Glory ohnehin wenig vorwerfen. Das ist akribisch und detailliert ausgestattet, wirkt in dieser Hinsicht äußert authentisch und besonders in den Schlacht-Szenen sieht es ziemlich beeindruckend aus. Da spart der Film auch nicht mit der angemessenen Grausamkeit und Konsequenz, zumindest in diesem Aspekt wird da wenig beschönigt. Dabei nehmen diese Sequenzen nur einen Bruchteil der Handlung ein, ein echtes Schlachtengemälde ist es nicht und soll es auch nicht sein. Was völlig in Ordnung ist, wenn er denn inhaltlich besser wäre. Ein großer Schwachpunkt ist zudem ausgerechnet Hauptdarsteller Matthew Broderick (über Ecken wohl wirklich mit dem echten Robert Gould Shaw verwandt), der sich mit dieser Rolle wohl von seinem durch Ferris macht Blau etablierten Teenie-Star Image lösen wollte. Das funktioniert leider kaum, da er von praktisch allen Nebendarstellern gnadenlos überschattet wird und oftmals eher wirkt, als hätte er das Halloween-Kostüm seines großen Bruders geklaut. Eine sehr verkrampfte und blasse Veranstaltung, die im Bezug auf den gewollten Imagewechsel eher kontraproduktiv erscheint.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org