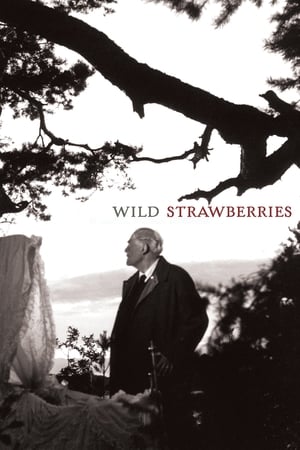Wie alle Charaktere, die Woody Allen (Hannah und ihre Schwester) Zeit seines Schaffens verkörpert hat, findet auch Harry nur dann eine Chance, sich zu sammeln, die Kontrolle über die Situation zurückzuerlangen, wenn er sich in einen wahren Redeschwall hineingesteigert: Lucy (Judy Davis, Naked Lunch), eine von Harrys unzähligen Verflossenen, hält ihn am Rand seiner Dachterrasse einen Revolver vor die Nase, weil Harry sie in seinem neusten Roman bloßgestellt, erniedrigt, entwürdigt hat. Und Harry? Der gibt sich im Bangen um sein Leben dem enthemmt-nervösen Sabbeln hin und entblättert eine ganz und gar entzückenden Geschichte, in der Harvey (Tobey Maguire, Der Eissturm) durch eine missliche Verwechslung Besuch vom Sensenmann bekommt. Lucy lacht, die Wogen scheinen halbwegs geglättet, Harry hat sich durch sein Sprachtalent mal wieder aus der Bredouille gerettet.
Augenscheinlich. Denn die Bredouille, in der sich Harry befindet, ist nicht einfach nur situativ, sondern umfasst sein ganzes Leben. Mehrere Ehen hat er bereits gegen die Wand gefahren, mehr als eine Handvoll Psychoanalytiker verschlissen und darüber hinaus ist er so dauergeil, dass er immer 500 Dollar in der Hosentasche bei sich trägt: Nuttengeld, wie er es nennt. Harry funktioniert dann, wenn er seinen Schmerz, sein Scheitern an der Realität, durch die Mittel der Schriftstellerei aufbereiten respektive aufarbeiten kann. Dass die Menschen, die ihm einst nahe standen, ihm an den Kragen wollen, wenn Harry sich diesen unverkennbar in seinen Roman annimmt, ist genauso nachvollziehbar wie der Umstand, dass Harry außer sich natürlich auch eine autobiographische Auseinandersetzung Woody Allens mit sich selbst ist: Willkommen in der selbstgeschaffenen Verwüstung.
Tatsächlich aber gibt es nur wenige Filme im gleichermaßen herausragenden wie umfangreichen Schaffen Allens, die gleichermaßen verspielt wie messerschaft mit ihren Charakteren ins Gericht gehen. Harry ist hier sowohl der nie erwachsen gewordene Unglückrabe wie er auch der in seinen Neurosen, Phobien, Trieben gefangene Genuis ist, der genau dann funktioniert, wenn er seine Wirklichkeit künstlerisch verwerten kann. Wenn Harry gegen Ende des Filmes erkennt, dass das Leben der Menschen immer aus der Verzerrung besteht, welche sie erwählen, dann scheint auch Woody Allen seine wahres Ich durchleuchtet zu haben. Ein hinreißend verkorkstes Ich, das dann funktionsfähig ist, wenn es zur eigenen Realität wird und nicht der Gefahr anheimfällt, der eigenen Inszenierung auf den Leim zu gehen. In dieser Erkenntnis kulminiert Allens seit Dekaden angesammelte Lebensweisheit.
Als Mensch, der sein Privatleben immer auch durch die Mühlen des öffentlichen Lebens respektive der bildenden Kunst gedreht hat, sind die Grenzen zwischen Fiktion und Wahrheit im Dasein von Woody Allen auch für ihn bereits derart untrennbar verschwommen, dass sich das New Yorker-Urgestein mit Harry außer sich endgültig der Frage stellt, wer er ist, wohin er will, wie er an diesen Punkt in seiner Existenz gelangen konnte. Und das gelingt ihm hier (mal wieder) mit einer ungeheuren rhetorischen Fabulierlust, mit einer humoristischen Treffsicherheit sowie der introspektiven Präzision, seinen Charakteren bis zu den Wurzeln ihrer seelischen Verheerungen zu folgen, dass man ihm ob all der Bissig- und Ruppigkeit, der Sensibilität und Genauigkeit, der entwaffenden Offenheit gegenüber den eigenen Fehlern und Ängsten nur stehende Ovationen spendieren möchte.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org