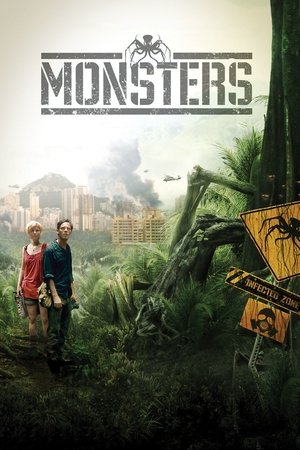Wie schön muss es doch sein, den Helden seiner Kindheit nicht nur auf dem Spielplatz Tribut zollen zu dürfen, sondern auch die Möglichkeit zu bekommen, ihnen ein rechtmäßiges Plätzchen mit einem Budget von über 200 Millionen Dollar auf der Kinoleinwand zu schenken. Dem neuseeländischen Fantasten Peter Jackson wurde dieses immense Privileg zuteil und er bekam die Chance King Kong und die weiße Frau, seinen Lieblingsfilm aus Kindertagen, neuzuverfilmen. Natürlich hat ihm dazu auch der enorme Erfolg seiner Der Herr der Ringe-Trilogie verholfen, für die Peter Jackson seiner Person bereits Legendenstatus verleihen konnte. Doch die Erwartungshaltung, die nach DerHerr der Ringe: Die Rückkehr des Königs in astronomische Höhenlagen geschnellt ist, konnte sich nur negativ auf alles Kommende seitens Peter Jackson auswirken. King Kong musste also zu einem dieser Projekte verdammt werden, die, trotz ihrer qualitativen Klasse, die Fans und Kritiker enttäuschen, einfach weil sie gezwungen sind, ihr Dasein im Schatten ihrer omnipräsenten Vorgänger zu fristen.
Dabei entzieht sich der direkte Vergleich zwischen King Kong und der Herr der Ringe-Saga eigentlich jeder Verhältnismäßigkeit, sind die Voraussetzungen und die Absichten doch ganz andere gewesen. Wie gut also ist King Kong, die Herzensangelegenheit, der verwirklichte Traum, nun wirklich? Peter Jackson, und das ist bei der persönlichen Verbindung, die er zur Vorlage pflegt, eigentlich nur logisch, betonte mehrfach, dass er King Kong allein für sich drehen würde – Ein Schutzmechanimus, der ein bevorstehendes Echo aus Buhrufen von vornherein neutralisieren sollte? Wohl kaum. Eher die klare Ansage, dass wir es hier mit einem Film zu tun bekommen werden, der mit einer gewissen Nostalgie verstrickt und aus der kindlichen Perspektive erzählt wird: Ein Abenteuer, das für leuchtende Augen und herunterklappende Kinnladen sorgen soll, ganz im Stil der früheren Magie eines Steven Spielbergs. Aber um die Ausgangsfrage zu beantworten, wie gut King Kong nun wirklich ist: Sehr gut, aber beileibe kein Meisterwerk.
Die Exposition im rekonstruierten New York des Jahres 1933 zeigt, wie geschliffen und detailverliebt heutige Animatorenteams für ein derartiges Period Picture arbeiten können: Die Gebäude wurden in historischer Akkuratesse nachempfunden und das Gefühl der Großen Depression jener Tage schleicht plastisch durch die exzellenten Aufnahmen. So weit das Auge reicht, so tief die Kamera schwenkt, wird dem Zuschauer ein nuanciertes Meer aus urbanen Impressionen offenbart, in dem sich unsere Protagonisten langsam zusammenfinden. King Kong lässt sich bald mehr als 70 Minuten Zeit, bis er auf der mystischen Insel Skull Island ankommt, positioniert reichhaltige visuelle Metaphern in das Geschehen und kennt dann, wenn die Schiffscrew und das Filmteam auf der Insel angekommen, kein Halten mehr: Im Stakkato nämlich lässt Peter Jackson megalomanische Action-Szenen auf den Zuschauer einprasseln, konfrontiert ihn erst mit dem Ritual der hiesigen Eingeborenen, bei dessen Anblick man sich klammheimlich ersehnt, Jackson würde doch mal eine echte Kannibalen-Replik inszenieren, um dann den unwirtlichen Dschungel unsicher zu machen.
Riesige Mammutbäume werden aus dem Boden gestampft, Wasserfälle brechen aus den Geröllwänden, Sümpfe erstrecken sich durch den ganzen Urwald und opulente Gesteinsbrücken wie Felsspalten verknüpfen mehrere tropische Zonen ineinander, die den Zuschauer in ihrer Anmut durchweg entzücken. Irgendwo und immer mittendrin befinden sich nicht nur Ann Darrow (Naomi Watts, Tage am Strand), die dem Riesengorilla zeremoniell geopfert wird, oder Carl Denham (Jack Black, School of Rock), Jack Driscoll (Adrien Brody, Der Pianist), Jimmy (Jamie Bell, Nymphomaniac) und Bruce Baxter (Kyle Chandler, The Wolf of Wall Street), die die blonde Dame aus den Fängen des augenscheinlichen Ungeheuers zu retten versuchen. Auch allerhand prähistorische Monster bekommen ihren großen Auftritt: Dinosaurier tummeln sich hier wie im Jurassic Park, mutierte Insekten schlängeln sich durch die hohlen Baumstämme, während hier und da noch seltsameres Fischgetier unter Wasser Jagd auf die Menschen macht. Da kommt es dann auch mal zu einer Saurierlawine – Hauptdarsteller: Der Diplodocus – und fertig ist der eskapistische Rausch in Reinform.
Das Drehbuch von King Kong aber macht den Fehler, den Zuschauer in dieser – einzig auf die Dramaturgie, nicht auf die Visualisierung bezogen - leider auch sehr absehbaren Gigantomanie schnell zu übersättigen. Wenn King Kong, der einsame acht Meter große Gorilla, dessen letzter Artgenosse den Eingang seiner Höhle mit seinem überdimensionalen Skelett ziert, inmitten verhangener Lianen in luftiger Höhe gegen gleich drei Dinosaurier kämpft, während er gleichzeitig Ann Darrow durch die Gegend jongliert, dann ist das schon etwas zu viel des Guten, wenngleich derlei Bilder das Kind in einem zum Staunen bringen werden. Wenn wir dann wieder im verschneiten New York angelangt sind, die Mythologie um Skull Island erschöpft ist und die Ruinen einer primitiven Zivilisation unbehandelt im Nirgendwo belassen werden, kommt es zur dramatischen wie ikonischen Klimax: Der Affe besteigt das Empire State Building, die Schönheit der blonden Frau wird sein Verhängnis. King Kong entzieht sich jedweder Rationalität, das ist immer wieder wichtig zu betonen, geht es doch durchweg um Emotionen. In diesem King Kong, einer respektvollen Hommage, allerdings sind es besonders Peter Jacksons Emotionen, die nahezu überschwappen.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org