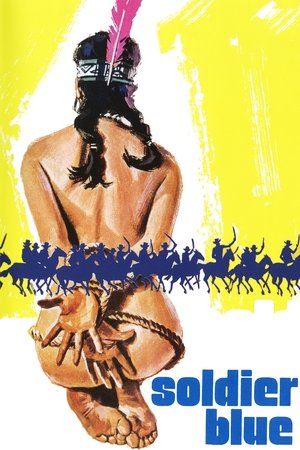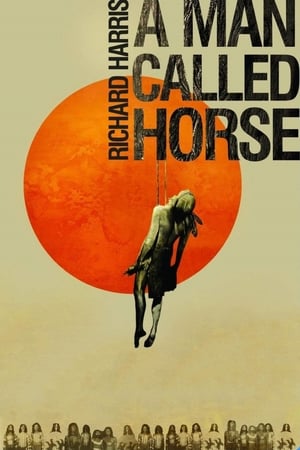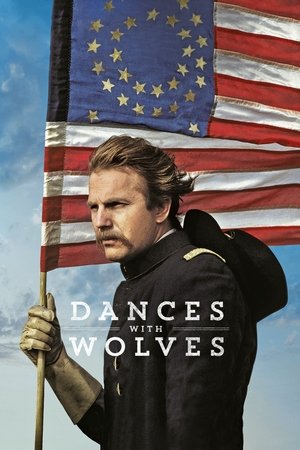Wenn man sich die Oscar-Gewinner der 1970er Jahre zu Gemüte führt, von Asphalt-Cowboy über French Connection – Brennpunkt Brooklyn bis hin zu Einer flog über das Kuckucksnest, dann möchte man der Academy, die in jener Dekade schalten und walten durfte, ein gutes Stück Urteilsvermögen mehr zusprechen, als den heutigen Verantwortlichen der Preisverleihung. Sicherlich, Fehlentscheidungen gab es immer, gibt es immer noch und wird es immer geben, doch dass ein Film wie Little Big Man einzig und allein in der Kategorie Bester Nebendarsteller (Chief Dan George) für einen Goldjungen nominiert wurde, scheint nicht gerade von gesundem Sachverstand zu zeugen. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Berger, im deutschsprachigen Raum unter dem Titel Der letzte Held publiziert, hätte sich die ein oder andere Trophäe verdient – seiner finalen Qualität aber tut dies selbstredend keinen Abbruch.
Arthur Penn, der drei Jahre zuvor mit Bonnie und Clyde einen Meilenstein des New-Hollywood-Kinos in Szene gegossen hat, hat sich mit Little Big Man vor allem eine Sache vorgenommen: Den klassischen Western gegen den Strich zu bürsten. Ausgangspunkt ist der nunmehr 121-jährige Jack Crabb (Dustin Hoffman, Die Reifeprüfung), der einem selbstgefälligen Reporter seine Lebensgeschichte unterbreitet. Dabei muss erwähnt werden: Jack Crabb ist eine rein fiktive Persönlichkeit. Die Geschichte, die Ergebnisse, die Erfahrungen, die diese ausstaffieren, aber sind keinesfalls fiktional. Mit zehn Jahren kam Jack zum ersten Mal in Berührung mit Indianern, einem Pawnee-Stamm, die seine Familie kaltblütig ermordeten. Im Schoß eines Cheyenne-Lagers wächst Jack zu einem Mann heran, erhält den Namen Little Big Man und findet sich alsbald wieder in der Zivilisation wieder. Als Mann, in dessen Brust zwei Herzen schlagen.
Das Rekurrieren auf historische Gegebenheiten nimmt Arthur Penn nicht zum Anlass, um eine im Detail stimmige Aufbereitung jener geschichtsträchtigen Epoche, in der General Custer, Sitting Hill und Crazy Horse zugegen waren, auszuwerten. Vielmehr definiert sich Little Big Man an Entmythologisierung des klassischen Westernfilms und verpflichtet sich einer Narration, die eindeutig den Indianern denn der Armee respektive den Siedlern gewogen ist. Vom schillernden Pioniergeist und dem oftmals damit verknüpften Pathos möchte Arthur Penn nichts wissen, stattdessen erzählt er von einem Land, in dessen Innerem nur Zerrissenheit lauert. Und dieses drückende Gefühl einer zerklüfteten Nation trägt er über den von Dustin Hoffman gespielten Jack Crabb aus: Ein Mann, der beinahe zu klein erscheint, um eine dermaßen beeindruckende Biographie aufzuweisen. Und genau das ist bereits die Methode, um eine klassische Heldenikonographie zu unterwandern.
Dass sich Arthur Penn auf die Seite der Indianer schlägt, scheint nur logisch anhand der intentionalen Marschroute, den traditionsbehafteten Western zu unterwandern. Allerdings ist Penn umsichtig genug, die Ureinwohner Amerikas niemals zu glorifizieren. Er nimmt sich ihnen hingegen mit Mitgefühl an, zeigt ihr gewalttätiges wie friedliebendes Naturell, schürt damit ebenfalls Ambivalenzen, aber verurteilt die Menschen, denen jeder Lebensraum genommen wurde, nicht. Auch in seinem Portrait der indigenen Völker behält sich Penn ein gewisses Maß an Widersprüchlichkeit aufrecht. Wen es allerdings wirklich bitter erwischt hat, ist General Custer (Richard Mulligan, Bonanza), der hier als unorganisierter Irrer gezeichnet wird und seine 7. Kavallerie im Zuge der Schlacht am Little Big Horn gnadenlos in ihr Verderben geführt hat. Ein beachtlicher Negativismus in einem darüber hinaus ohnehin beachtlichen Film.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org