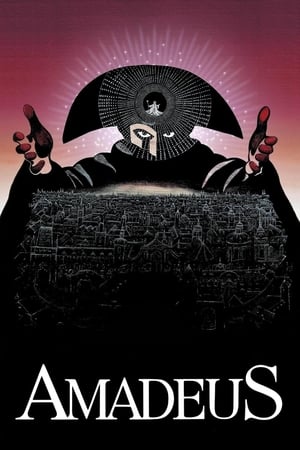Nach ihrem Meisterwerk Lost in Translation, in dem Bill Murray (Rushmore) und Scarlett Johansson (Black Dahlia) als verlorene Seelen durch das melancholische Lichtermeer Tokios streifen und auf magisch-unwirkliche Weise zueinander finden, stimmte Sofia Coppolas (Somewhere) Entscheidung, als nächstes einen Film über Marie Antoinette drehen zu wollen, zunächst skeptisch. Mit dem nach seinem realen Vorbild benannten Film hat die Regisseurin dann aber doch kein Biopic gedreht, in dem die Lebensgeschichte der französischen Königin wie aus dem Geschichtsbuch nacherzählt wird, sondern ein Werk, das Coppolas unverkennbaren Stil in sich trägt.
Aufgrund der opulent eingerichteten Originalschauplätze, für die dem Drehteam unter anderem uneingeschränkter Zutritt im Schloss Versailles genehmigt wurde, und exklusiv angefertigten Kleidungsstücken wie die edlen Schuhe von Manolo Blahnik könnte man Marie Antoinette leicht als bloße Kostüm- und Ausstattungsorgie abstrafen. Genau dieser verschwenderische Luxus ist es aber, dem die erst 14 Jahre alte Maria Antonia ausgesetzt wird, nachdem sie als Tochter der österreichischen Kaiserin von ihrer Mutter dazu gezwungen wird, den französischen Thronfolger zu heiraten, um fortan ein Leben als Marie Antoinette zu führen. Erwartet wird dabei von ihr, dass sie ihrem frisch angetrauten Ehegatten so schnell wie möglich Nachwuchs beschert.
Mit dem Auftakt ihres Films unterstreicht Coppola allerdings sofort, dass sie sich der historischen Persönlichkeit auf ganz eigene Weise annähern will, indem sie das Wesen des noch recht jungen Mädchens beleuchtet. In den ersten 20 Minuten spricht die von Kirsten Dunst (Spider-Man) hervorragend gespielte Protagonistin kaum ein Wort und fügt sich stumm in die Rolle ein, die ihr zu Beginn auferlegt wird. Als sie zum ersten Mal aus der Kutsche steigt und französischen Boden betritt, wird sie von zwei Frauen aus der Ferne belächelt, die sagen, sie sehe noch wie ein Kind aus. Als dieses Kind dann durch die prunkvollen Räumlichkeiten des Anwesens geführt wird, reagiert es mit schüchterner Verunsicherung, kann ein neugieriges, angetanes Funkeln in den Augen jedoch nie ganz verbergen.
Spätestens hier wird klar, dass Marie Antoinette von der Regisseurin als Coming-of-Age-Film konzipiert wurde. Ein Motiv, das Coppola auf ähnliche Weise bereits in ihrem Langfilmdebüt The Virgin Suicides - Verlorene Jugend verwendete, um unter der Oberfläche lauernde Abgründe in jugendliche Unschuld und verträumte Schleier zu kleiden. Trotz des geschichtlichen Kontexts ist Marie Antoinette in diesem Film ebenfalls in erster Linie ein Mädchen auf der Schwelle vom Kindesalter hin zur verwirrten Jugendlichen voller Tatendrang, die sich allem voran von ihren spontanen Gefühlsausbrüchen leiten lässt.
Als Pubertierende, die dem streng durchstrukturierten Königshof unterworfen und in monotonen Abläufen und Ritualen gefangen gehalten sowie von ihrem ständig abwesenden Ehemann angeödet wird, macht Marie Antoinette folglich das, was wohl die meisten Mädchen in ihrem Alter in dieser Situation tun würden. In ausschweifenden Bildkompositionen führt Coppola die ebenso frustrierte wie gelangweilte Protagonistin in einen Konsumexzess aus Pastell- und Bonbonfarben. Zuckersüße Desserts im Übermaß, Gläser voller Champagner, im Sekundentakt wechselnde Schuhpaare, lüstern ausgetauschte Blicke auf einem Maskenball oder ausgiebige Spaziergänge im malerischen Hofgarten unterlegt die Regisseurin hierbei wahlweise mit klassischer Musik oder schwungvollen Songs der Neuzeit.
So erstrahlt Marie Antoinette als inszenatorisch ausgelassenes Pop-Porträt zwischen Barock und Moderne, in dem die politische Brisanz absichtlich aus der Perspektive der Protagonistin in den verschwimmenden Hintergrund verbannt wird. Auch das Ende, in dem der wütende Mob mit brennenden Fackeln und Mistgabeln zur Revolte anrückt, wirkt Coppola-typisch wie das Erwachen aus einem wohligen Traum, bei dem die nahende Realität abrupt weggeschnitten wird, bevor sich der wirkliche Schrecken zeigt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org