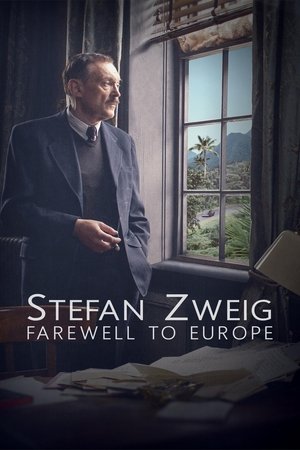Quelle: themoviedb.org
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org

- Start 26.01.2017
- 95 Min DramaHistorieBiografie
- Regie Pablo Larraín
- Drehbuch Noah Oppenheim
- Cast Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, Caspar Phillipson, John Carroll Lynch, Beth Grant, Max Casella, Sara Verhagen, Hélène Kuhn, Deborah Findlay, Corey Johnson, Aidan O'Hare, Ralph Brown
Kritik
Fazit
Kritik: Patrick Reinbott
Beliebteste Kritiken
-

Kritik von saarfranke
Wer bei Jackie ein opulentes Biopic über das Leben Jackie Kennedys erwartet, über ihre Herkunft, ihre Zeit im Amt, oder ihr Leben nach ihrer Zeit im weißen Haus, der wird wohl enttäuscht werden. Denn statt Jaqueline Kennedys Biografie verfilmt Larraín hier nur einen kurzen Zeitraum nach der Ermordung des Präsidenten.Als Aufhä...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×