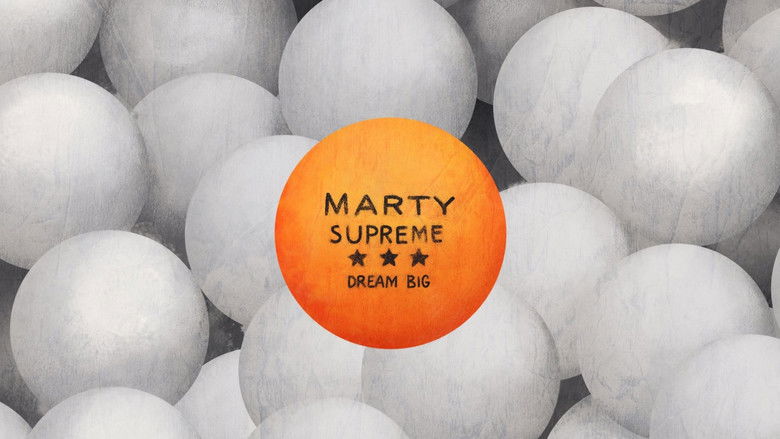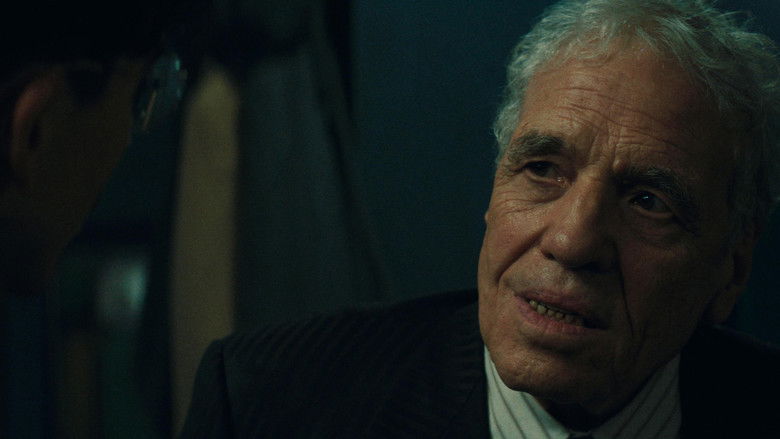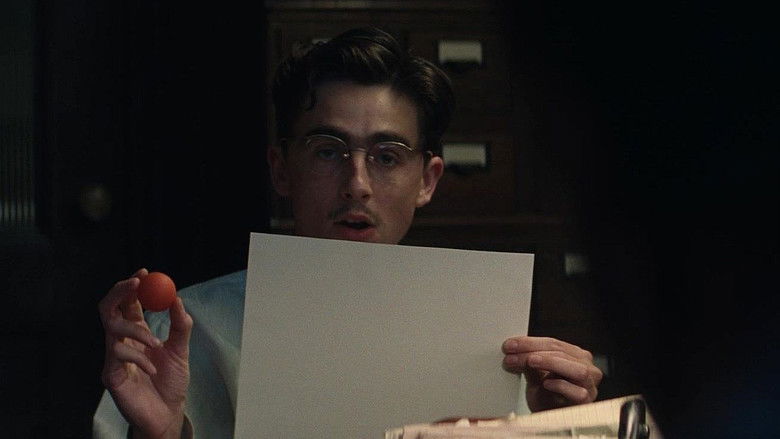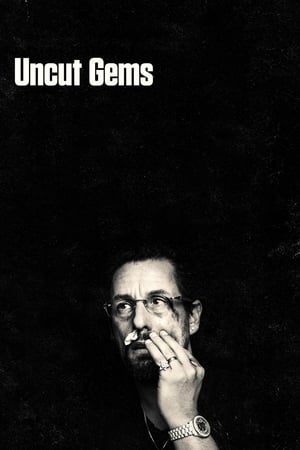In einer Gegenwart, die wahrlich nicht an Sympathieträgern überreich ist, erweist sich Josh Safdies Entscheidung als ebenso konsequent wie klug: Für sein erstes Solo-Projekt ohne Bruder Ben stellt der Autorenfilmer keinen angenehmen Helden ins Zentrum, sondern einen Mann, der jede Form von Empathie systematisch unterläuft. Marty Supreme ist ein Biopic, das sich nur lose an realen Begebenheiten orientiert und deutlich mehr Fabel als Tatsachenbericht sein will. Genau darin liegt seine Stärke. Denn Marty Mauser, angelehnt an den exzentrischen US-Tischtennisspieler Marty Reisman, ist überheblich, selbstverliebt und von einer Maßlosigkeit, die schnell abstößt – und dennoch kaum den Blick freigibt.
Safdie interessiert sich nicht für moralische Rehabilitation oder psychologische Glättung. Marty will der Beste sein. Nicht aus sportlicher Reinheit, sondern aus verletztem Stolz und hemmungslosem Ehrgeiz. Um sich selbst zu beweisen, dass er über allen anderen steht, braucht er Geld. Und um an dieses Geld zu kommen, verbündet er sich mit dem Stiftmagnaten Milton Rockwell, einem Mann, der ebenfalls jede Form von Anstand wie Ballast behandelt. Was auf dem Papier unerquicklich klingt, entfaltet im Film eine eigenartige Sogwirkung. Safdie erzählt keine klassische Aufstiegsgeschichte, sondern eine rastlose Odyssee durch ein Amerika der Egomanen, Blender und Verlierer.
Rastlosigkeit als Prinzip: Kino im Dauerlauf
Wie schon in Uncut Gems kennt Marty Supreme keinen Stillstand. Gedanken dürfen nicht reifen, sie werden vom nächsten Impuls überrannt. Szenen enden selten dort, wo man sie erwartet, Dialoge wirken wie improvisierte Schlagabtäusche, die jederzeit eskalieren können. Diese permanente Bewegung ist keine bloße Stilübung, sondern der emotionale Pulsschlag des Films. Marty lebt im Dauerrausch seiner Selbstüberschätzung, und Safdie zwingt das Publikum, dieses Tempo mitzugehen.
Visuell findet Kameramann Darius Khondji dafür eine Bildsprache, die Energie und Eleganz miteinander verbindet. Nach seiner beeindruckenden Arbeit an Eddington zeigt er sich erneut in Hochform. Die Bilder besitzen Wucht und Rhythmus, ohne sich in formaler Eitelkeit zu verlieren. Alles ist in Bewegung, aber nichts wirkt beliebig. Auch der Soundtrack verweigert sich konsequent historischer Genauigkeit. Anachronismus ist hier kein Gag, sondern Haltung. Wenn der Film selbst ikonische Popmomente – etwa eine überraschende Referenz an den Vorspann von Kuck mal, wer da spricht! – renoviert, entsteht eine schräge, fast respektlose Komik, die perfekt zur Weltsicht der Hauptfigur passt.
Marty Supreme will kein Sittengemälde sein und schon gar keine moralische Lehrstunde. Der zweieinhalb Stunden lange Film gleicht eher einem Märchen, erzählt aus der Perspektive eines Mannes, der sich selbst für einen Prinzen hält, obwohl weder Charakter noch Erscheinungsbild zu diesem Selbstbild passen. In Safdies Universum gibt es kaum aufrichtige Figuren. Betrug ist Alltag, Rücksichtslosigkeit eine Grundhaltung. Selbst vermeintlich Unschuldige sind selten frei von Eigennutz.
Tischtennis als Seelenkampf: Sport ohne Erlösungsversprechen
Besonders bitter ist dabei die beiläufige Grausamkeit, mit der Machtfiguren ihre Umgebung manipulieren – bis hin zu Momenten, in denen selbst das Leid des KZ-ÜberlebendenBela (Géza Röhrig, Son of Saul) instrumentalisiert wird. Umso bemerkenswerter ist es, dass Safdie genau dieser Figur die reinste, stillste und zugleich rätselhafteste Szene überlässt. Sie steht quer zum restlichen Geschehen und bleibt lange im Gedächtnis. Wie vieles in Marty Supreme lässt sich auch dieser Moment in mehrere Richtungen lesen – als Hoffnungsschimmer, als bitterer Kommentar oder als ironische Brechung.
Überraschend gut funktioniert der Titel auch als Sportfilm. Die Tischtennismatches sind sparsam eingesetzt, entwickeln aber vor allem in den Duellen zwischen Marty und seinem Rivalen Endo (Koto Kawaguchi) eine echte Spannung. Safdie inszeniert diese Begegnungen nicht als technische Schauwerte, sondern als psychologische Kräftemessen. Jeder Ballwechsel wird zum Spiegel der Figuren, ihrer Eitelkeiten und Neurosen.
Figuren, denen man lieber auf der Leinwand begegnet als davor
Getragen wird das Ganze von einer Besetzung, die kaum besser passen könnte. Timothée Chalamet (Like A Complete Unknown) liefert als Marty Mauser eine herausragende Leistung. Sein Spiel balanciert präzise zwischen Abstoßung und Faszination. Marty ist ein Trampel, ein rücksichtsloser Ich-Mensch, und doch spürt man unter all der Selbstverliebtheit eine echte, wenn auch fehlgeleitete Leidenschaft. Diese Mischung macht die Figur so unberechenbar. Chalamets körperliche Präsenz, sein übersteigertes Selbstvertrauen und seine ständige Grenzüberschreitung halten den Film am Leben. Ohne diese Exzesse würde Marty Supreme in sich zusammenfallen.
Gwyneth Paltrow (Iron Man) überzeugt als ehemalige Diva Kay Stone, und legt damit einen Auftritt hin, der gerne als Comeback gewertet werden darf. Abseits der (auch im deutschen Raum) prominenten Namen glänzt der Film mit einem Casting, das man nur als punktgenau bezeichnen kann. Kevin O'Leary, vielen aus der US-Version von Die Höhle der Löwen bekannt, überrascht als Rockwell mit einer Präsenz, die jede Szene dominiert. Sitcom-Queen Fran Drescher, The King of Comedy-Darstellerin Sandra Bernhard, TV-Magier Penn Jillette, Rapper Tyler The Creator, Bühnenautor David Mamet (Glengarry Glen Ross) und sogar Kult-Regisseur Abel Ferrara (King of New York) fügen sich nahtlos in dieses wilde Ensemble ein. Altbekannte Gesichter wirken hier seltsam neu, fast entfesselt, während Odessa A'zion (Until Dawn) als Martys Geliebte sich für weitere große Rollen empfiehlt.
Marty Supreme ist anstrengend, aber auf eine produktive Weise. Der Film fordert Aufmerksamkeit, Geduld und Bereitschaft zur Überforderung. Er ist laut, überdreht und gelegentlich hemmungslos. Doch genau darin liegt seine Faszination. Man verlässt das Kino erschöpft, aber erfüllt – dankbar dafür, dass es noch Filme gibt, die sich jeder Glättung verweigern. Und dankbar dafür, Marty Mauser nur im dunklen Schutz des Kinosaals begegnet zu sein. In der Realität sollten Arschlöcher schließlich deutlich weniger glänzen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org