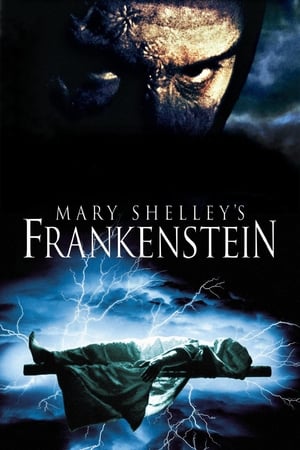Mit dem 2012 erschienenen Das Mädchen Wadjda gelang Regisseurin Haifaa Al Mansour etwas ganz und gar Historisches: Die durchaus regimekritische, voller einmaliger Alltagsbeschreibungen steckende Emanzipationsgeschichte eines jungen Mädchens, welchem es verboten ist, Fahrrad zu fahren, stellt den ersten Film dar, der vollständig in dem autoritär regierten Königreich Saudi-Arabien verwirklicht wurde. Kaum verwunderlich ist es nun, dass sich Mansour für ihr englischsprachiges Debütwerk dazu entschieden hat, sich dem Leben von Mary Shelley anzunehmen. Mit Frankenstein oder Der moderne Prometheus lieferte sie einen literarischen Meilenstein ab, der ihrem grundsätzlichen Vorhaben, dem Vorwärts- und Vorantreiben der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, einen ungeheuren Dienst erwies. Mary Shelley – Die Frau, die Frankenstein erschuf ist aus thematischer Sicht nun die logische Weiterentwicklung von Das Mädchen Wadjda.
Allerdings trägt Mary Shelley – Die Frau, die Frankenstein erschuf weder die filmhistorische respektive kulturpolitische Bedeutung inne, wie es Das Mädchen Wadjda nach wie vor tut, noch begegnet der Film seiner Protagonistin auf sinnstiftende, erkenntnisbringende Art und Weise. Man muss sich mit dem Leben von Mary Shelley nicht sonderlich gut auskennen, um schnell zu merken, dass das Drehbuch, an dem Haifaa Al Mansour ebenfalls mitgeschrieben hat, seltsame Rückschlüsse zieht, wenn es darum, die Kunst mit der Person, die sie erschaffen hat, in eine Verbindung zu bringen. Zwanghaft und in überaus geistloser Handhabung versucht man sich hier daran, im Alltag von Mary Shelley (Elle Fanning, The Neon Demon) immer mehr Beweggründe und Motive zu entdecken, warum sich eine junge Frau dazu hat hinreißen lassen, eine Geschichte wie die von Frankenstein und seinem Monster zu verfassen.
Eine stimmige Antwort wäre es schon gewesen, weil Mary Shelley schon immer einen morbiden Faible für die zeitgenössische Schauerliteratur besaß. Für Mansour aber waren es die bitteren Schicksalsschläge, die die aufstrebende Schriftstellerin dazu getrieben haben, von einer aus Leichenteilen zusammengesetzten Kreatur zu berichten, die zum Leben erweckt wird. Im Kern sind es genau zwei einschneidende, obligatorisch weibliche Erfahrungen, die Mary Shelley machen muss, um die musische Energie aufzubringen, jenen Klassiker niederzuschreiben: Sie muss ein Kind verlieren und sie muss von ihrem Liebsten (Douglas Booth, Stolz und Vorurteil und Zombies) betrogen werden. Das kann man so bringen, man sollte sich künstlerisch dann allerdings darauf konzentrieren, die Psychologie der Figuren halbwegs ausgereift nachzuzeichnen, um sie nicht, so wie es bei Mary Shelley – Die Frau, die Frankenstein erschuf der Fall ist, in seifige Telenovela-Gefilde abrutschen zu lassen.
Mary Shelley – Die Frau, die Frankenstein erschuf wirkt vorwiegend küchenpsychologisch, verkürzend und dramaturgisch unbeholfen. Allein der Versuch, von einer großen Liebe zu berichten, dieser aber jedwede Form von urwüchsiger Leidenschaft abhanden kommen zu lassen, zeigt bereits auf, wie wenig erzählerische Stringenz Haifaa Al Mansour aufbringt, um sich in die Lebensrealität der Frau einzufühlen, die ihrer Zeit fraglos voraus war. Stattdessen bekommt man hier ein konventionelles Biopic in säuberlich arrangierten Bildern abgeliefert, welches kaum Eigendynamik oder Ambivalenz besitzt und darüber hinaus die Gefühlswelt seiner Protagonistin so plump und einfältig ausformuliert, dass es einem um die wunderbare Elle Fanning in der Hauptrolle fast schon leid tut. Die nämlich gibt sich durchaus Mühe, ihrem Charakter Kontur zu verleihen, wird aber vom stumpfen Drehbuch immer wieder ausgebremst.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org