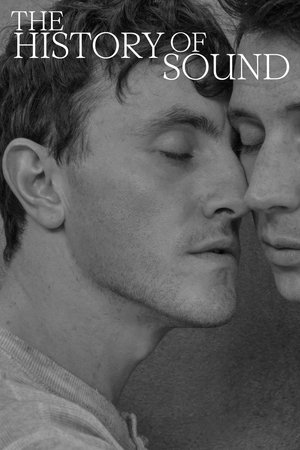Daniel Minahan (Deadwood) hat sich im Laufe seiner Karriere eine sehr eigene Nische geschaffen: Er ist ein Regisseur, der weniger an klassischen Spannungsbögen interessiert ist als an Stimmungen, an ästhetischen Oberflächen, an der Frage, wie eine bestimmte Zeitperiode aussieht, klingt, ja theorethisch sogar riecht. Seine Arbeiten wirken häufig, als würde er das historische Amerika nicht rekonstruieren, sondern neu träumen wollen. On Swift Horses ist dabei eine klare Weiterführung dieses Ansatzes – ein Film, der seine narrative Struktur beinahe zweitrangig behandelt, um stattdessen das Gefühl einer Epoche zu destillieren. Die 1950er erscheinen hier nicht als konkret erfahrbare Realität, sondern als Raum, in dem Sehnsüchte, Abweichungen und gesellschaftliche Zwänge wie in einem flirrenden Dunst schweben. Minahan komponiert seine Bilder mit fast manischer Präzision. Dadurch entsteht ein Film, der auf formaler Ebene permanent von sich behauptet, etwas Bedeutendes zu erzählen. Doch hinter der Fassade liegt ein bemerkenswert stiller Kern. Die Inszenierung verfolgt eine Klarheit der Atmosphäre, die zugleich Bewunderung und Frustration hervorruft. Schönheit ist hier kein Nebenprodukt, sondern Selbstzweck – und dieser Selbstzweck ist so dominant, dass der Film sich immer wieder von seinen eigenen Figuren entfernt, als wolle er verhindern, dass zu viel Gefühl die Komposition stören könnte.
Genau an dieser Stelle beginnt die zentrale Spannung von On Swift Horses. Denn Minahans visuelles Konzept steht in einem spürbaren Widerspruch zu dem inneren Chaos seiner Figuren. Muriel (Daisy Edgar-Jones), Julius (Jacob Elordi), Lee (Will Poulter) – und die Figuren, die sich um dieses Dreieck gruppieren – tragen Geschichten in sich, die von innerer Zerrissenheit, unterdrückten Sehnsüchten, riskanten Entscheidungen und gesellschaftlicher Unsichtbarkeit geprägt sind. Die emotionalen Impulse sind da, und die Darsteller*innen greifen sie auf jeden Fall auch intensiv auf. Daisy Edgar-Jones etwa arbeitet mit einer extrem reduzierten Mimik, die den Raum zwischen Verletzlichkeit und stillem Aufbegehren offenhält. Jacob Elordi dagegen spielt Julius mit jener magnetischen Lässigkeit, die mittlerweile zu seiner Signatur geworden ist: Er steht nicht einfach im Bild, er sitzt darin wie ein Rätsel, schwer fassbar und doch klar definiert. Und Will Poulter verleiht seinem Lee eine rührende Empathie, die zwar nie zur dominanten Kraft wird, aber als melancholischer Unterton jede Szene einfärbt, in der er auftaucht. Das Problem ist jedoch, dass Minahan all diese Darbietungen häufig in einer Bildsprache platziert, die Distanz erzeugt, nicht Nähe. Übergänge erfolgen abrupt, Begegnungen entstehen ohne organisches Wachstum, und manche emotional aufgeladenen Momente wirken, trotz ihrer inszenatorischen Eleganz, fast wie geplante Choreografien bei einem Theaterstück. Die daraus entstehende Leerstelle wird nicht automatisch zum künstlerischen Kommentar, sondern manchmal einfach zum Gefühl, dass etwas Wesentliches fehlt: Die Gelegenheit, uns wirklich in die Figuren hineinversetzen und mit ihnen fühlen zu können.
Diese Spannung zwischen ästhetischer Kontrolle und emotionaler Zurückhaltung wird indes besonders deutlich in Szenen, die eigentlich tiefgreifende Intimität erzeugen sollen. Auch Las Vegas, eigentlich ein Ort des Kontrollverlusts, wird hier zur Bühne eines strengen visuellen Konzepts, in dem das Chaos der Stadt erstaunlich ordiniert erscheint. Die Welt wirkt wie poliert, gebügelt, gegen Unebenheiten imprägniert – ein Widerspruch, der interessanterweise sowohl die Faszination als auch die Schwäche des Films darstellt. Minahan versteht es klar meisterhaft, Schönheit zu erzeugen. Er versteht es jedoch weniger, diese Schönheit emotional aufzuladen. Und so entsteht eine paradoxe Situation: On Swift Horses ist voller starker Einzelmomente, voller mutiger Entscheidungen, voller Darstellerleistungen, die weit über das Drehbuch hinausweisen – und dennoch bleibt er auf einer emotionalen Ebene unvollständig. Der Film ringt um eine Wahrhaftigkeit, die er nie ganz erreicht. Er weiß, was er zeigen will, aber nicht, wie er es fühlen lassen soll. Was bleibt, ist ein Kinoerlebnis, das sich anfühlt wie ein perfekt gedeckter Spieltisch, an dem die Karten zwar kunstvoll gemischt wurden, der entscheidende Einsatz jedoch ausbleibt. Schade.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org